Geschichte meines Lebens
(1962)–Henry Van de Velde–
[pagina 385]
| |
Zwölftes Kapitel
| |
[pagina 386]
| |
Gebiet des Vierwaldstätter Sees untergebrachten Internierten zu bessern, die als Kunstgewerbler auf einem Niveau beschäftigt wurden, das demjenigen einer Elementarschule oder eines geistlichen Pensionates für vierzehn- oder fünfzehnjährige junge Mädchen entsprach. Auf Grund eines von mir verfaßten Berichtes wollte er die Berliner Behörden veranlassen, ihm die Reorganisation der Werkstätten dieser Lager zu gestatten, wodurch er auch das künstlerische Niveau der dort geleisteten Arbeit zu verbessern gedachte. Ich besuchte die Lager, stellte fest, daß die Zustände so waren, wie er sie mir dargestellt hatte, und erstattete einen mündlichen Bericht, der seine Meinung bestätigte. Nach dieser Fühlungnahme mit General Friedrich unternahm ich Schritte, um die belgische Gesandtschaft über meine Anwesenheit in der Schweiz und über meinen besonderen Fall zu unterrichten: daß mir eine ‘Staatsangehörigkeit’ auferlegt worden war, die ich während der langen Jahre meines Aufenthaltes in Deutschland nie zu erwerben gesucht, weil ich niemals auch nur daran gedacht hatte, meine belgische Staatsangehörigkeit aufzugeben, auch nicht in dem Augenblick, als meine belgischen Freunde wenige Monate vor Ausbruch des Krieges meine Rückkehr nach Belgien verwirklichen wollten, sich aber darüber klarwurden, daß mir mein Vaterland nie eine materielle Situation bieten konnte, die nur einigermaßen meinen Möglichkeiten in Weimar entsprach. Ich setzte alle meine Hoffnungen in eine Besprechung mit dem belgischen Gesandten, von dem ich erwartete, daß er meine Beziehungen zu meinem Vaterland regelte, wie sie mit Deutschland geregelt waren, das heißt auf der Basis vollkommener Loyalität und gegenseitigen Vertrauens. Ich rechnete damit, mit der Darstellung des Konfliktes, der mich seit mehr als zwei Jahren marterte, bei dem offiziellen Vertreter meines Vaterlandes Verständnis zu finden. Ich wollte ihm die Bedrückungen und Härten vor Augen führen, die ich erduldet hatte und die auch in der Schweiz auf mir lasteten: die Trennung von den Meinen, die durch die kleinste Ungeschicklichkeit, durch irgendein dummes Wort von mir Gefahr liefen, als Geiseln behandelt zu werden. Vor allem informierte ich Octave Maus, der als Flüchtling in Lausanne das belgische Konsulat leitete, über meine Anwesenheit in der Schweiz. Wir konnten uns einmal treffen, allerdings nur in Gegenwart eines Dritten, was mich - leider - hinderte, ihm anzuvertrauen, was ich ihm anver- | |
[pagina 387]
| |
trauen wollte. Meine treue Freundin Madeleine, Octave Maus' Frau, schrieb mir: ‘Es treibt mich, Ihnen ein Wort zu schreiben, um unserem nächsten Zusammensein ein persönliches Zeichen vorausgehen zu lassen, wie es Octave auch getan hat. Auf bald, mein lieber Freund, ich umarme Sie. Madeleine.’ Trotz aller Bemühungen, die Octave Maus, Maurice Kufferath und andere belgische Freunde unternahmen, für mich eine Audienz beim belgischen Gesandten zu erwirken, um die ich selbst so dringend gebeten hatte, entzog sich der Vertreter meines Vaterlandes einer Zusammenkunft mit mir. Er hätte ihnen gegenüber mich angreifen können, um ihr Vertrauen in mich zu erschüttern; er hätte sagen können, es wäre ‘klüger’ von mir gewesen (um ein deutlicheres Wort zu vermeiden), nicht mit den deutschen Behörden in Verbindung zu treten, deren Macht über mich er kannte und die sich aus der ‘Staatsangehörigkeit’ ergab, über die er von Octave Maus unterrichtet worden war. Er hätte von mir selbst die Einzelheiten meiner tragischen Lage hören können - aber er zog es vor, wie ein anderer Funktionär der Geschichte, ‘sich die Hände in Unschuld zu waschen’. | |
Begegnungen mit Künstlern und Intellektuellen
| |
[pagina 388]
| |
Dort begegnete ich schon am Abend meiner Ankunft dem temperamentvollen elsässischen Dichter und Schriftsteller René Schickele, der mich mit dem spanischen Journalisten Alvarez del Vayo bekannt machte. Man bedauerte, daß ich erst jetzt gekommen war. Wäre ich einen Tag früher erschienen, so hätte ich noch Lenin und seine revolutionären Freunde getroffen, die ihr Hauptquartier im ‘Café du Théâtre’ aufgeschlagen hatten. Am Morgen meiner Ankunft hatten sie im plombierten Wagen Bern verlassen, um nach Rußland zurückzukehren. Ich interessierte mich lebhaft für René Schickele, dessen Theaterstück ‘Hans im Schnakenloch’ während des Krieges in Deutschland Triumphe erlebt hatte. Wie sein Freund Grumbach lebte Schickele als Flüchtling in der Schweiz. Grumbach war ein entschiedener Anhänger der Rückgliederung des Elsaß an Frankreich; Schickele neigte mehr zur Gründung eines autonomen Landes, das mit seinen Traditionen, den elsässischen Sitten und Bräuchen ebenso verbunden bleiben sollte wie mit dem Humanismus und der Kunst Frankreichs. Der deutschen Muttersprache nach sollten die elsässischen Intellektuellen und Schriftsteller eigentlich nach Deutschland tendieren. Aber ihr Charakter und ihre Mentalität stehen dem Geist Rabelais und Voltaires näher als dem Goethes oder der Romantiker. Ihre Sympathie gilt mehr der französischen Leichtigkeit als der deutschen Schwere, deren Pedanterie die durch ein engstirniges und arrogantes Besetzungsregime entstandene Abneigung steigerte. Der Konflikt, den René Schickele in seinem Stück auf die Bühne gebracht hatte - der Gegensatz zwischen dem elsässischen, Frankreich zugewandten Künstler und seiner Braut, die den vollendeten Typ des zarten, kultivierten, schönen deutschen Mädchens darstellt -, stand in den feurigen Augen seines schönen Gesichtes geschrieben, das von dichtem Haarwuchs umgeben war. Seine junge, liebenswürdige Frau, eine schöne Rheinländerin, war möglichst immer um ihn, weil sie wußte, daß ihre Anwesenheit auf die explosive Natur ihres Mannes beruhigend wirkte. Oft nahmen mich die Schickeles spät in der Nacht in irgendein Lokal mit, wo René mit einem ausländischen Journalisten verabredet war, der allerneueste Neuigkeiten mitbrachte. Seine Frau war stets bereit, seine verschiedensten Kapricen mitzumachen; oft bat sie mich, mit ihnen auszuhalten; wir wohnten ohnehin in der gleichen Straße und hatten den gleichen Heimweg. | |
[pagina 389]
| |
Bei solchen Streifzügen fand ich einige deutsche Freunde wieder, die ich seit Beginn des Krieges nicht mehr gesehen hatte. Einmal war es Paul Cassirer, der mir später den großen Dienst leistete, meine Bildersammlung nach der Schweiz zu bringen, durch deren Verkauf ich leben und die Übersiedlung meiner Familie in die Schweiz vorbereiten konnte. Ich sah ihn mehrere Male. Er war vom deutschen Propagandadienst beauftragt worden, in Zürich, Bern, Genf und Lausanne Ausstellungen zu organisieren. Cassirers Frau, die berühmte Schauspielerin Tilla Durieux, war von der gleichen deutschen Stelle für Gastspiele engagiert, die mit den von der französischen Kulturpropaganda veranstalteten Vorstellungen der ‘Comédie Française’ wetteifern sollten. Neben Tilla Durieux befanden sich in der deutschen Truppe brillante Berliner Schauspieler und Schauspielerinnen, wie die Eysoldt, die Höflich und Lina Lossen. Es waren denkwürdige Abende, an denen Paul Cassirer in einem kleinen Zürcher Hotel alle Künstler um sich scharte. An einem dieser Abende begegnete ich der hochbegabten Dichterin Else Lasker-Schüler, um die sich im Kreise der Intellektuellen und Künstler eine Legende gebildet hatte. Abgesehen von ihren sonstigen exzentrischen Eigenheiten hatte sie sich für ihre Freunde und Bekannten den Namen ‘Prinz von Theben’ zugelegt. Unter diesem Titel umgab sie sich mit einem Gefolge komischer kleiner weiblicher Dichterlinge, die ihr in einer Wolke starker orientalischer Parfüms folgten, wohin immer sie sich begab. Paul Cassirer liebte dieses Milieu mit seinen Festen und ließ sich als ‘Kaiser von Jerusalem’ verehren. Eines Abends traf ich ihn von einem Harem umgeben; er trug ein prächtiges altes Kostüm, hatte eine goldene Krone auf dem Kopf und wirkte mit seiner mächtigen Gestalt wie ein wirklicher Sardanapal. Für mich bedeuteten solche Abende Stunden der Zerstreuung und Ablenkung von meinem anomalen Zustand, der meinen Feinden Anlaß bot, gegen mich zuerst heimlich, dann offen in Belgien perfide Intrigen vorzubereiten und Minen zu legen, die in dem Augenblick springen sollten, wenn ich nach dem Kriege nach Belgien zurückkehren wollte. | |
[pagina 390]
| |

113 E.L. Kirchner: Holzschnittporträt Henry van de Veldes, 1917
| |
[pagina 391]
| |
Besuch bei Ernst Ludwig KirchnerIm Gedanken an den Jenenser Kunsthistoriker Botho Graef suchte ich Ernst Ludwig Kirchner in Davos auf, ein wahres Opfer des Krieges; der höllische Wahn, in die Schlacht zurückgeschickt zu werden, hatte ihn verwirrt und hilflos auf das armselige Bett eines drittklassigen Hotels geworfen. Graef war einer der ersten gewesen, der unsre, von ihm leidenschaftlich unterstützte Gruppe in Weimar auf Kirchner hinwies, die bedeutendste Gestalt der expressionistischen Künstlervereinigung ‘Die Brücke’ in Dresden, zu der außer Kirchner noch Pechstein, Heckel, Nolde und Schmidt-Rottluff gehörten. Damals war es in Deutschland keineswegs außergewöhnlich, daß Professoren der Kunstgeschichte künstlerische Neuerer verteidigten. Befanden sich nicht auch Richard Muther und Paul Clemen - der erstere Kunsthistoriker der Universität Breslau, der zweite Ordinarius in Bonn - unter denen, die mich frühzeitig geschätzt und verteidigt haben? Botho Graef war einer der ersten Käufer von Gemälden und graphischen Blättern Kirchners; er veranlaßte auch mehrere seiner Universitätskollegen, Werke seines Schützlings zu erwerben. Kirchner hatte uns nie in Weimar besucht. Er wäre zweifellos mit dem gleichen Verständnis und der gleichen Begeisterung aufgenommen worden wie Edvard Munch, der zeitweise bei uns in Weimar lebte. In Davos fand ich einen abgemagerten Menschen mit stechendem, fiebrigem Blick, der den nahen Tod vor Augen sah. Er schien entsetzt, mich an seinem Bett zu sehen. Seine Arme preßte er konvulsiv an die Brust. Unter seinem Hemd verbarg er seinen Paß wie einen Talisman, der ihn mitsamt der schweizerischen Aufenthaltsbewilligung vor dem Griff imaginärer Feinde bewahren konnte, die ihn den deutschen Behörden ausliefern wollten. Der Hotelier hatte mir von diesem Wahn und von den Anfällen Kirchners erzählt, die die Wahnvorstellungen zur Folge hatten. Offenbar hielt mich Kirchner für einer Beamten der Polizei. Es schien, daß er unter der Einwirkung von Mitteln stand, die er übermäßig gebrauchte. Im Verlaufe mehrerer Tage gewann ich langsam sein Vertrauen und fragte dann bei meinen Freunden Binswanger in Kreuzlingen an, ob sie bereit seien, Kirchner in ihr Sanatorium aufzunehmen. Ich war froh, der zustimmenden Antwort zu entnehmen, daß sie sich, allein aus dem Gefühl der Menschlichkeit, mit besonderem | |
[pagina 392]
| |
Interesse Kirchners annehmen wollten. Bevor die Reise gewagt werden konnte, wartete ich noch einige Tage in Davos. Kirchner war nun zutraulicher geworden. Wir sprachen von seinen Werken, von meinen und meiner Freunde Bestrebungen in Weimar, von seinem Freund und leidenschaftlichen Bewunderer Botho Graef. Nach und nach legte sich seine Erregung. Die Aussicht auf eine andere Umgebung und Atmosphäre, in die ich ihn bringen wollte, beruhigte ihn. Ich versuchte, ihm seine Gesundung vor Augen zu führen, die Möglichkeit, wieder zu arbeiten, den Park in Kreuzlingen, die Nähe des Bodensees und vor allem das Verständnis, das Dr. Ludwig Binswanger seinem Schaffen entgegenbrachte. Dr. Binswanger werde ihm helfen, das physische Gleichgewicht wiederzugewinnen, und ihn von den seelischen Nöten befreien, die nicht mit Drogen, sondern nur durch ein gesundes Leben bekämpft werden könnten. Ich war überzeugt, daß Binswanger Kirchner wiederaufrichten und seiner Kunst zurückgeben würde. Und so kam es auch nach einiger Zeit, die Kirchner im ‘Parkhaus’ zu Kreuzlingen verbrachte. Kurz vor Kriegsende schrieb mir Dr. Binswanger, daß er Kirchners Wunsch zustimme, das ‘Parkhaus’ zu verlassen und sich in die Berge Graubündens zu begeben, zu denen er sich hingezogen fühlte. Er wollte seine Gefährtin zu sich kommen lassen und dachte nicht mehr daran, jemals wieder nach Deutschland zurückzukehren. | |
Zusammentreffen mit dem Sozialisten Camille Huysmans,
| |
[pagina 393]
| |

114 E.L. Kirchner: Holzschnittporträt Henry van de Veldes, 1917
| |
[pagina 394]
| |
in Bern Station. Bei unserem Zusammensein im Hotel wurden wir von Angestellten des Hauses scharf überwacht - sie umschwärmten uns förmlich unter dem Vorwand, uns ständig zu bedienen -, und als wir endlich einen stillen Winkel gefunden hatten, erschien ein Elektriker, der unaufhörlich Lampen auswechselte, Kontakte oder Schalter reparierte, in Wirklichkeit aber den Auftrag hatte, unser Gespräch zu belauschen, das weder kompromittierend noch umstürzlerisch war. Camille empfahl mir dringend, nach Stockholm überzusiedeln, wo man mich mit Vergnügen aufnehmen würde. Ich berichtete ihm über meine delikate Lage und über den toten Punkt, an den meine Beziehungen zu unsrer Gesandtschaft gelangt waren. Huysmans hat den Dingen immer gerade ins Auge geschaut. Seine Entwicklung als Politiker - er ist später belgischer Staatsminister geworden - hat ihm als Waffe jene argwöhnische Einstellung gegeben, die bereit ist, Schläge zu empfangen und dem Gegner mit Ironie zu antworten. Seine Stockholmer Reise zeigte, wie er den heftigsten und gehässigsten Angriffen standhalten konnte, die seine Teilnahme an einem Kongreß, bei dem auch deutsche sozialistische Abgeordnete anwesend waren, nach seiner Rückkehr in Belgien hervorrief. Von diesem Augenblick an war er für die große Mehrheit der Belgier ‘der Mann von Stockholm’. Er trug diesen negativ gemeinten Namen mit Stolz und übernahm die volle Verantwortung für das Zusammentreffen mit dem ‘Feind’ auf einem Feld, auf dem die Waffe des Generalstreiks - unter anderem - ebenso wirksam werden konnte wie die Waffen der Armeen. Ich komme auf meine Beziehungen zu Camille Huysmans später zurück. Er war es, der mich in seiner Funktion als Minister der Künste und der öffentlichen Erziehung in den zwanziger Jahren nach Belgien zurückberief. In der Zwischenzeit nahm er es auf sich, bei meinen belgischen Freunden für meine Loyalität zu bürgen.
Schon vor dem Zusammentreffen mit Camille Huysmans fühlte ich mich in Bern von Spionen jeder Sorte und der verschiedensten Nationalität umgeben, was übrigens nichts Außergewöhnliches war. Eines Tages erhielt ich den Besuch eines Priesters, offenbar eines verkleideten Subjekts, das Auskünfte über Deutschland aus mir herausholen wollte und das ich unverzüglich hinauswarf. Ein paar Tage später wurde mein Briefkasten erbro- | |
[pagina 395]
| |
chen. Das Fieber der Spionage verpestete die Luft. Ich war nicht allein davon betroffen. René Schickele und auch Annette Kolb, die ich bei den Schickeles traf, waren ebenfalls Opfer der deprimierenden Überwachung. Bei Schickeles fanden sich Angehörige der verschiedensten Nationen ein, Freunde der Alliierten wie Anhänger der Deutschen. Annette Kolb hatte ich schon vor dem Krieg kennengelernt. Sie war Gast bei meinen Freunden in Neubeuern, auf Schloß Wendelstadt, und ich traf sie auch in verschiedenen Berliner Salons, wo man sie verwöhnte. Ihr Vater war Bayer, ihre Mutter Französin. Mit Frankreich war sie doppelt verbunden: durch die Bewunderung, die ihr Vater, Hofgärtner der bayrischen Krone, den großen französischen Gartenarchitekten entgegenbrachte, und durch die kulturellen Bande ihrer Mutter. Schon in ihrer Jugend besaß sie eine eigene Prägung, durch die sie sich von allen anderen deutschen Schriftstellerinnen unterschied. Sie stand im Ruf eines Originals, war unabhängig, sarkastisch, eine Bohème-Natur. In Bern befand sie sich dadurch in einer der meinigen und Schickeles ähnlichen Lage, daß sie durch eine administrative Maßnahme einen Paß mit doppelter Nationalität besaß. Sie hatte kein Bedürfnis nach einem eigenen Heim oder auch nur nach einem Zimmer, um zu arbeiten und sich mit Büchern zu umgeben, die sie vor der Einsamkeit schützten. Sie schrieb keine Zeile ihrer Romane oder Essays an einem Schreibtisch, sondern arbeitete in den großen Cafés bei den Klängen von Zigeunermusik oder auf den Terrassen der großen Hotels. Ihre Kleidung war sorgfältig, streng, bescheiden und ausgesprochen unmodisch, was keineswegs hinderte, daß ein besonderer Charme von ihr ausging.
Ich behielt zunächst meinen Wohnsitz in Bern. Aber die Anziehungskraft, die die künstlerischen Kreise Zürichs auf mich ausübten, veranlaßte mich zu häufigen Besuchen in Zürich, das ein internationaler Treffpunkt der Intellektuellen geworden war. Diese ‘Internationale’ setzte sich unter anderem aus dem ungarischen Schriftsteller Andreas Latzko, dem deutschen Schriftsteller Leonhard Frank, dem Komponisten und Pianisten Ferruccio Busoni und dem Wiener Pazifisten Dr. Elias zusammen, der mit seiner Frau später nach Lugano übersiedelte. Der Freund des Wiener Ehepaares war der Dichter Fritz von Unruh; er war der Hölle von Verdun entronnen und durch das Rote Kreuz nach der Schweiz verbracht worden. Wie durch ein Wunder | |
[pagina 396]
| |
wurde er durch die Sorge der Ärzte und die moralische Hilfe des Ehepaares Elias von den Folgen einer an der Front erlittenen Gasvergiftung gerettet. Kurz vorher hatte er das Buch ‘Verdun’ veröffentlicht, das in Deutschland und im ganzen deutschen Sprachbereich den gleichen tiefen Widerhall gefunden hatte wie ‘Feuer’ von Henri Barbusse im französischen Sprachbereich. Ihrem Stoff nach sind beide Bücher fast identisch; beide entstanden aus Abscheu vor dem Krieg. Und beide Bücher sind vom literarischen wie vom menschlichen Gesichtspunkt aus gleichwertig. Aber sie hatten sehr verschiedene Folgen für das Schicksal ihrer Verfasser. ‘Feuer’ war für Barbusse der erste Schritt auf einer großen Laufbahn, wenn er auch nach dem Krieg eine politische Überzeugung verbreitete, die einen großen Teil seiner Leser blendete; ‘Verdun’ hingegen wurde Fritz von Unruh von seinen Landsleuten nicht verziehen, so daß er sich entschloß, endgültig ins Exil zu gehen.
Ferruccio Busoni traf ich zum ersten Male beim Dirigenten des Züricher Tonhalle-Orchesters Volkmar Andréä. Ich erinnere mich nicht, jemals gleichzeitig vom Zauber, vom Ernst und von der Leichtigkeit, mit der sich ein Künstler über das Wesentliche seiner Kunst äußerte, derart unmittelbar erobert worden zu sein wie von Busoni. Er schöpfte aus den Quellen profunder Überlegungen und gründlicher Forschungen auf den Gebieten der verschiedenen Künste: ein gelehrter Musikwissenschaftler, leidenschaftlicher, genialer Pianist, Kenner der literarischen Schätze aller Sprachen. In seinem kleinen, reizvollen Zürcher Appartement, das er während des Krieges bewohnte, unterhielten wir uns nach einem Essen, das uns Busonis Frau Gerda serviert hatte, über die Beziehungen von Musik - seiner Kunst - und Architektur - der meinigen. Die Selbstverständlichkeit, mit der er diese Beziehungen, die man nicht ernst genug nehmen kann, darstellte und analysierte, die technische Präzision, mit der er von meinem ‘Metier’ sprach, während ich mich unfähig fühlte, die geeigneten Worte für seine Kunst zu finden, erregten mein höchstes Erstaunen. Im Anschluß an eine diskrete Bemerkung seiner Frau erklärte Busoni, daß, als ihn eine unüberwindliche Abneigung ergriff, dem Publikum und den europäischen Höfen als Wunderkind vorgeführt zu werden, eine solche Leidenschaft für die Architektur in ihm erwachte, daß er bereit war, auf die Musik zu verzichten, um sich der Architektur zu widmen. | |
[pagina 397]
| |
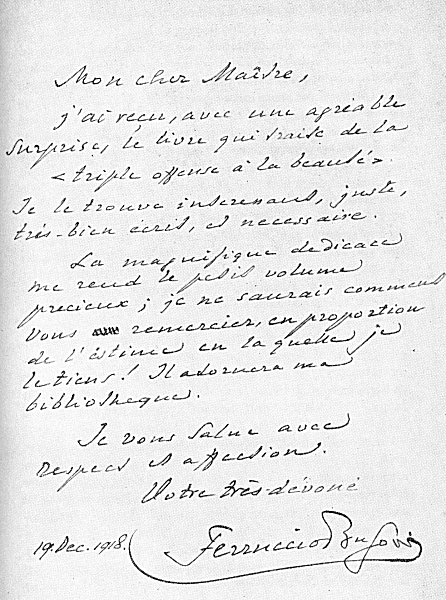
115 Brief von Ferruccio Busoni an van de Velde vom 19. Dezember 1918
| |
[pagina 398]
| |
Es machte mir Freude, bei diesem Gespräch festzustellen, daß Busoni in der musikalischen Komposition der Konstruktion eine besondere Wichtigkeit beimaß. Später vertiefte ich mich in seine Ideen über Musik bei der Lektüre seiner bedeutenden Studie ‘Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst’, die in der ‘Insel-Bücherei’ erschienen ist. Dabei stellte ich fest, daß das, was ich unter ‘Konstruktion’ verstand, nicht mit dem Begriff korrespondierte, den Busoni in der zeitgenössischen musikalischen Komposition als typisch modern bezeichnete. Die mit Busoni in Zürich verbrachten Stunden sind mir besonders teuer und die Sympathie für den genialen Musiker und ausnehmend scharfsinnigen und kultivierten Künstler besonders lebendig geblieben.
In Bern traf ich auch Graf Kessler wieder. Er war von der russischen Front, wo er sich von Kriegsbeginn an befand, nach Bern versetzt worden, um in der Schweiz deutsche Kultur- und Kunstpropaganda zu organisieren. England und Frankreich hatten auf diesem Gebiet schon seit langem große Anstrengungen unternommen und bedeutende Geldmittel aufgewendet. Besonders die ausgezeichnet organisierte französische Propaganda erzielte glänzende Erfolge und setzte die künstlerische Überlegenheit Frankreichs in helles Licht. Interessante Ausstellungen französischer Kunst, erstrangige Vorträge, Theateraufführungen, unter denen neben der ‘Comédie Française’ auch die Avantgarde-Bühne Lugné-Poes und andere erschienen, Orchesterkonzerte unter der Leitung berühmter Dirigenten lösten einander ab, lange bevor man in Deutschland auch nur daran dachte, etwas Ähnliches zu tun. Als man sich in Deutschland dazu entschloß, erinnerte man sich an Harry Graf Kessler und seine Tätigkeit in Weimar. Kessler und ich beschlossen, unsre persönlichen Beziehungen nicht zu ändern. Niemand wußte besser als er, daß unsre Freundschaft in den internationalen künstlerischen Kreisen bekannt war; weder er noch ich wollten etwas verbergen. Aber ich beteiligte mich praktisch nicht an seiner Aktivität und wohnte seinen Veranstaltungen nur als einfacher Mann aus dem Publikum bei. Das hinderte mich nicht, gelegentlich Künstler, Schriftsteller, Musiker oder Schauspieler zu treffen, die von Kessler engagiert worden waren. Ich erinnere mich besonders an eine Begegnung mit dem Schauspieler Alexander Moissi, mit dem mich Kessler zu einem privaten Lunch in einem Ber- | |
[pagina 399]
| |
ner Restaurant einlud. Wir beide bewunderten Moissi als genialen Schauspieler und schätzten seine menschlichen Qualitäten. Da Harry Kessler ständig zwischen Bern und Berlin hin und her fuhr, wurden unsre Begegnungen von selbst seltener. Zudem neigte sich meine Berner Zeit ihrem Ende zu. Während meines Berner Aufenthaltes veranstaltete der Deutsche Werkbund, dessen frühes Mitglied ich gewesen war, eine bedeutende Ausstellung in Bern. Die Leitung des Werkbundes wünschte dringend meine Teilnahme an dieser Manifestation unter den gleichen Voraussetzungen, unter denen ich als Ausländer an der Kölner Werkbundausstellung 1914 teilgenommen hatte. Ich beschloß jedoch, mich der Veranstaltung fernzuhalten, und legte der Leitung des Deutschen Werkbundes die Gründe meiner Entscheidung schriftlich dar. Der ‘Bund’, die meistgelesene Berner Zeitung, die in einer Notiz meine Teilnahme gemeldet hatte, veröffentlichte auf meinen Wunsch eine Berichtigung mit der Angabe der Gründe, die mich zu meiner Stellungnahme veranlaßt hatten. | |
Vorträge in Bern und Zürich - Übersiedlung nach ClarensZu Beginn des Jahres 1918 hielt ich im Rahmen des ‘Cercle artistique franco-suisse’ einen Vortrag. Der ‘Cercle’ wurde von dem angesehenen Berner Advokaten Brüstlein geleitet, der durch seine radikale frankophile Haltung in scharfer Opposition zu der eher deutschfreundlich eingestellten Berner Regierung stand. Gerade deswegen besaß Brüstlein große Autorität und starken Einfluß in den künstlerischen und intellektuellen Kreisen Berns, die offen für die Alliierten Partei ergriffen. Bei meiner Abreise aus Weimar hatte ich kein geschriebenes oder gedrucktes Material mitnehmen können, das mir als Unterlage für Vorträge hätte dienen können. Deshalb wählte ich ein mir vertrautes Thema, das sich mit John Ruskin, William Morris und mir selbst als ihrem legitimen Nachfolger befaßte. Der Titel des in französischer Sprache gehaltenen Vortrages lautete: ‘La triple offense à la Beauté’ (Die drei Sünden wider die Schön- | |
[pagina 400]
| |
heit). Der Vortrag war sehr stark besucht, und unter den Zuhörern befanden sich außer den Mitgliedern des ‘Cercle’ viele Künstler und vor allem Angehörige des Schweizerischen Nationalrates und vieler Gesandtschaften, die in Bern ihren Sitz hatten. Meine Ausführungen wurden mit lebhaftem Interesse aufgenommen und mit starkem Beifall ausgezeichnet. Zwei Wochen darauf wiederholte ich den Vortrag auf Einladung eines literarischen Vereins in Zürich. Der Vortrag erschien in der von René Schickele im Verlag Max Rascher in Zürich herausgegebenen Serie ‘Europäische Bibliothek’ als Nummer 5. Die vorhergehenden Bände enthielten eine Schrift von Henri Barbusse, einen Essay von H.G. Wells, eine Anthologie von Gedichten von Kriegsteilnehmern verschiedener Nationen und einen Essay von Leonid Andrejew. Karl Scheffler schrieb mir, daß sich die deutsche Version meines Vortrags wie ein Original lese. Das war René Schickeles Verdienst, der meinen französischen Text ins Deutsche übertragen hatte.
Bei meinen häufigen Überlegungen, eine Grundlage für mein definitives Verbleiben in der Schweiz zu finden - die erwartete baldige Ankunft meiner Familie wirkte als starke Triebfeder -, beschäftigte ich mich mit dem Gedanken, Werkstätten ins Leben zu rufen, wie ich sie in Weimar besessen hatte. Meine Pläne wurden in verschiedenen Berner Kreisen besprochen und gut aufgenommen. Trotz eines gewissen Kastengeistes und vieler Vorurteile herrschte damals in der Berner Gesellschaft jedem Ausländer gegenüber, der als politischer Flüchtling gekommen war, eine Atmosphäre des Wohlwollens und der Toleranz. Mit der Gründung von Werkstätten plante ich ein Unternehmen, dem ich alles, was ich noch an Kräften besaß, widmen wollte. Einmal mehr war ich voll und ganz bereit, mich einem fremden Land zu verbinden, das aus meiner Arbeit Nutzen für das eigenen Kunsthandwerk und für die Kunstindustrie ziehen konnte. Durch Vermittlung des belgischen Militärattachés, Oberst Lefébure, des Bruders meines in Belgien verbliebenen Freundes, hatte ich die belgische Gesandtschaft von meinen Plänen unterrichtet. Aber wiederum ließ mein Vaterland, gleichgültig gegenüber meinen Bestrebungen und ohne Rücksicht auf meine schwierige persönliche Lage, sich - diesmal bewußt - die Gelegenheit entgehen, mich in einem entscheidenden Moment meines Lebens wiederaufzunehmen. | |
[pagina 401]
| |
Meine vor allem durch Dr. Solf und Wilhelm von Bode unterstützten dringenden Gesuche bei den deutschen Behörden in Berlin führten nach langen Monaten endlich dazu, daß meine älteste Tochter Nele zu mir nach Bern kommen konnte. Mit dem Beginn des Frühjahrs 1918 verließen wir meine einfache Berner Wohnung und zogen nach Clarens am Genfer See in eine bescheidene Pension. Ich war froh, den heißen Boden Berns mit seiner Atmosphäre des Mißtrauens und der Spionage verlassen zu können. Aber einige Berner Freunde fehlten mir; zum Beispiel Dr. Fried, der Herausgeber einer internationalen pazifistischen Zeitschrift, in dessen gastlichem Hause ich Ricarda Huch begegnete. Ihre männliche Persönlichkeit zog mich nicht weniger an als ihre Schönheit. Ich lernte ihre Werke kennen, in denen sie in höchst eindrucksvollen Darstellungen das Leben der Revolutionäre aller Zeiten geschildert hat, der Helden und Märtyrer der Aufstände, der Unabhängigkeit und der Freiheit. Damals war gerade ihr ‘Garibaldi’ erschienen, von dem ein deutscher Kritiker sagte, man könnte sich bei dem Gedanken ärgern, daß eine Frau ein so männliches Werk geschrieben habe. Während der Monate, die wir in Clarens lebten, hatte ich Gelegenheit Maurice Kufferath näher kennenzulernen, der mit seiner Frau in der gleichen Pension wohnte wie wir. Als Direktor des Brüsseler ‘Théâtre de la Monnaie’ hatte er als erster in Belgien Wagners Nibelungenring in das Repertoire aufgenommen. Seine Frau Lucy, eine glühende Pazifistin, veröffentlichte zur Zeit ihres Aufenthaltes in der Schweiz mutige Bücher. Auch H.R. Lenormand und seine Gefährtin Marie Kalff zogen wenige Wochen vor Abschluß des Waffenstillstandes in unsre kleine Pension. H.R. Lenormand war der vieldiskutierte Wortführer einer Gruppe Pariser Dramatiker, die einen heftigen Kampf gegen jene Berühmtheiten führte, die als Lieferanten für die Boulevard-Theater Stücke zuschneiderten. Zu einer Zeit, als Sigmund Freud und seine Theorien über das Unbewußte in Frankreich noch unbekannt waren, drang Lenormand als Dramatiker in die unerforschten Bereiche der Seele ein. Lenormands Gefährtin, die Holländerin Marie Kalff, war eine Intellektuelle großen Stils und eine Schauspielerin, deren außergewöhnliches Talent ihr die Bewunderung Lugné-Poes und die Freundschaft von Eleonora Duse eingetragen hat. Als meine Tochter und ich ihr begegneten, hatte sie gerade begonnen, ‘große Rollen’ zu spielen. Durch die beiden Lenormands lernten wir auch die russischen Schauspieler | |
[pagina 402]
| |
Georges und Ludmilla Pitoëff kennen, die während des Krieges in Genf eine Truppe gebildet hatten, die bald auf der großen Bühne der ‘Comédie’, bald in winzig kleinen Sälen der verschiedenen schweizerischen Ortschaften am Genfer See auftrat. Diese Freundschaften und Beziehungen milderten meine allmählich zur Besessenheit gewordene Sorge um meine Frau und die in Weimar zurückgebliebenen Kinder, die in Gefahr standen, den Launen deutscher Funktionäre ausgesetzt zu werden. Sie linderten auch meine Nervosität der deutschen Gesandtschaft und den Konsulaten gegenüber, die beauftragt waren, meine Schritte und Äußerungen zu kontrollieren, die gegebenenfalls als Bruch meines Eides ausgelegt werden konnten, den ich vor Erhalt des Passes nach der Schweiz hatte ablegen müssen: ‘nichts zu sagen und nichts zu unternehmen, was Deutschland schaden könnte’. | |
Frans Masereel - Romain RollandIn Clarens erinnerte ich mich an meinen früheren Schüler Jules de Praetere. Auch er hatte, enttäuscht, seine Heimat Belgien verlassen. Als Reorganisator der Gewerbeschulen in Zürich und Basel hatte er in der Schweiz Karriere gemacht. Ich erfuhr, daß er in Genf lebte und sich leidenschaftlich der Malerei widmete. Als ich ihn besuchte, sprachen wir über mein Schweizer Werkstättenprojekt und seine Chancen. Vor allem aber machte er mich auf einen jungen Künstler aus Gent aufmerksam, der in der kleinen Tageszeitung ‘La Feuille’ einen erbitterten Kampf gegen den Krieg und die Verdummung des Menschen führte. Ich wollte mehr über diesen jungen Mann wissen und begegnete ihm bald. Abend für Abend brachte er seine satirischen Zeichnungen, deren Wirkung er durch beißende Titel noch steigerte, auf die Redaktion des bescheidenen Blattes, dessen treue Leser durch ihn in ihrer Kritik und pazifistischen Überzeugung bestärkt wurden. Sehr rasch entstand zwischen ihm und mir eine Verbindung, die heute noch so frisch und fest ist wie damals: meine Freundschaft mit Frans Masereel. Ihm, René Schickele und Annette Kolb, die alle mit dem berühmten Verfasser des ‘Jean Christoph’ freundschaftliche Beziehungen unterhielten, | |
[pagina 403]
| |
habe ich es zu danken, daß ich den geschmähten, von allen Nutznießern des Krieges am meisten gehaßten Menschen kennenlernte, der als Flüchtling in Villeneuve am Genfer See lebte: Romain Rolland. Er war besser als irgend jemand über die Menschen und das geistige Leben in Deutschland vor 1914 orientiert. Auch über die Rolle, die ich in der gleichen Zeit gespielt hatte, wußte er Bescheid. Als ich erfuhr, daß Romain Rolland meinen Besuch erwartete, wurde ich von einem Gefühl devoter Bewunderung ergriffen. Ich sah in ihm den einzigen Menschen, der imstande war, eine zukünftige Epoche internationalen Friedens zu planen und die auseinandergebrochene Humanität wiederaufzurichten. Ich war mir der Größe dessen, den ich aufsuchte, bewußt und wurde von plötzlicher Unruhe ergriffen bei dem Gedanken, daß Romain Rollands erste Geste, mit der er mir die Hand reichen, und das Fluidum, das von ihm ausgehen würde, für unsere zukünftigen Beziehungen entscheidender seien als irgendwelche Worte! Die Erinnerung an den Augenblick, in dem Romain Rolland das erste Mal vor mir stand, bleibt meinem Gedächtnis eingeprägt. Am Ende einer langen Glasgalerie, in der ich wartete, öffnete sich eine Tür. Rollands Gang war gemessen, seine Haltung bescheiden und überraschend korrekt. Rolland reichte mir die Hand, bevor ich die seine ergreifen konnte. Wir sahen uns genau an. Ich war von der Farbe seiner Augen und von dem Wohlwollen frappiert, das aus ihnen strahlte. Wir standen einige Zeit unbeweglich. Dann nahmen wir zusammen den Tee ein und plauderten: von Deutschland natürlich, von gemeinsamen Freunden, auch von den Umständen, die mein Schaffen brutal vernichtet hatten, von den Schwierigkeiten, vor denen ich mich befand. Nichts konnte ihn aus meinen Antworten die Ergriffenheit ahnen lassen, die ich dem Manne gegenüber empfand, den wir als das Gewissen der Menschheit betrachteten. Nichts in seiner Haltung ließ irgendeinen priesterlichen Hintergedanken erkennen; im Gegenteil: er erschien mir als ein Mensch, der einfach seine Pflicht erfüllt und keine Spur von Verehrung erwartet. Ich teilte ihm mit, daß die Redaktion der schweizerischen pazifistischen Zeitschrift ‘Die Weißen Blätter’ mich um einen Beitrag gebeten hatte, daß ich aber zögerte, ihr einen Abriß des Textes zu geben, dessen Stoff und | |
[pagina 404]
| |
endgültige Form mich beschäftigten. Romain Rolland bat mich, den Text kennenlernen zu dürfen. Ich erklärte ihm meine Befürchtung, die Idee der Wiederannäherung, der Versöhnung, die unser Ziel sei, könne uns von Schiebern entwendet werden, deren merkantile Beweggründe nur neuen Schaden anrichten würden; die Geschäftemacher könnten seine, Rollands, Anstrengungen, Kämpfe und Opfer ausnützen, was ebenfalls unseren Idealen schädlich werden müßte. Denn die Kaufleute würden ohne Zweifel als die ersten die Grenzen passieren. Sollten wir ihnen nicht den Weg versperren und die Scheinheiligkeit ihrer Versöhnungsbereitschaft anprangern? Romain Rolland blieb stumm und die Frage ohne Antwort bis zu dem Moment, als er seinen klaren, transparenten Blick ebenso fest auf mich richtete wie bei unsrer ersten Begrüßung. Dann sagte er: ‘Schicken Sie mir das Manuskript.’ Als die Stunde kam, in der die Glocken aller Kirchtürme an den Ufern des Genfer Sees das Ende der Kriegsschrecken verkündeten, begab ich mich nach Villeneuve, um mich von Romain Rolland zu verabschieden; vor allem aber um ihn zu bitten, in der Schweiz zu bleiben. Seine Freunde und seine pazifistischen Gesinnungsgenossen fürchteten, daß er bei der Rückkehr nach Frankreich von den ‘Patrioten’ und Nutznießern des Krieges nur mit Hohn empfangen, daß er fanatischen Exzessen, ja der Bedrohung seines Lebens von seiten seiner Feinde ausgesetzt sein würde, gegen die er so überlegen und unerbittlich gekämpft hatte. Ich entwickelte ihm meinen Plan, am schweizerischen Ufer des Bodensees eine Kolonie unabhängiger Künstler ins Leben zu rufen und ein Institut zu gründen, das ein Zentrum künstlerischer Kultur sein sollte. Romain Rolland hörte mir mit größter Aufmerksamkeit zu, während er meine Hand fest in der seinen hielt. Seine durchdringenden, klaren, hellblauen Augen fixierten mich, als er die Worte aussprach, die sich mir unauslöschlich einprägten: ‘Sie, mein lieber Freund, sollen sich nirgends festsetzen. Sie sollen sich auf den Weg machen und predigen!’ | |
[pagina 405]
| |

116 Brief von Romain Rolland an van de Velde vom 27. März 1919
| |
[pagina 406]
| |
UttwilBei meinen Ausflügen am schweizerischen Ufer des Bodensees, die ich zur Zeit der Übersiedlung Kirchners ins Sanatorium Bellevue zu Dr. Binswanger machte, entdeckte ich das Dorf Uttwil und ein dort gelegenes, altes, unbewohntes Patrizierhaus in einem herrlich verwilderten Garten, dessen hohe, mächtige Mauer, die vom Garten aus gesehen nur fünfzig Zentimeter hoch war, unmittelbar an den See grenzte. Die Mauer bildete an ihrem Ende einen kleinen Fischerhafen. Am verfallenen Landungssteg legte ab und zu ein mit Baumaterial oder Kohle beladenes Lastschiff an. Das Ganze war ein Traum, wie geschaffen für einen poetisch empfindenden Künstler, der für seine Familie mit fünf Kindern ein Obdach sucht! Der Gedanke, dieses Besitztum mieten oder erwerben, mich nach Kriegsende mit den Meinen hier niederlassen und Schüler um mich versammeln zu können, verließ mich nicht mehr. Gerüchte über einen plötzlichen Frieden, die seit Juni oder Juli 1918 umliefen, nahmen immer festere Gestalt an. Ich hatte meine - persönliche - Entscheidung getroffen. Es blieb mir nichts anderes zu tun, als die Konsequenzen aus der Lage zu ziehen, in der ich mich während des ganzen Krieges befunden hatte. Das Schicksal hatte mich außerhalb der Grenzen meiner Heimat gestellt; zugleich hatte es meinen Horizont erweitert. Nach Belgien zurückzukehren, hätte bedeutet, mich Umständen anzupassen, von denen sich mein verändertes Wesen losgelöst hatte. Da ich mich nicht entschließen konnte, Europa zu verlassen, nach Amerika zu gehen und mich dadurch endgültig von dem Schauplatz der künstlerischen Ziele zurückzuziehen, für die ich mehr als zwanzig Jahre gekämpft hatte, war es eine logische Entscheidung, in der Schweiz zu verbleiben. Welche Enttäuschung hätte ich meinen Freunden bereitet, denen gegenüber ich von der Scheune gesprochen hatte, in die wir die Ernte unsrer gemeinsamen Arbeit einbringen wollten! Das Haus in Uttwil konnte diese Scheune werden und das Dorf am Ufer des Bodensees der Ort, wo man sich wieder vereinte. Als ich annehmen konnte, daß meine Frau und meine Kinder in absehbarer Zeit ihre Pässe erhielten, erwarb ich das Haus in Uttwil. Ich mußte aber noch bis zur Kapitulation Deutschlands warten, ehe ich auf die Unterstützung meiner Freunde im Lager der deutschen Revolutionäre zählen | |
[pagina 407]
| |
konnte, unter denen mir der ehrwürdige sozialistische Veteran Eduard Bernstein besonders wertvolle Hilfe geleistet hat. Bald nach der Kapitulation kam meine Frau mit den Kindern in Romanshorn an, von wo aus meine Tochter Nele und ich sie nach Uttwil brachten. Aus ihren abgezehrten, harten Zügen, in den erloschenen Augen, aus den abgebrauchten Kleidern konnte man die traurigen Umstände lesen, denen sie endlich hatten entrinnen können. Die Unendlichkeit des Sees, der Garten mit seinen sprießenden Pflanzen, der verfallene, wackelige Landungssteg - alles erregte helles Entzücken, und nicht zum wenigsten der mit einem Überfluß an Speisen bedeckte Tisch! Meine Pläne - zunächst die Gründung einer kleinen Kolonie von Freunden - und die Freiheit unseres neuen Lebens zerstreuten die letzten Befürchtungen meiner Frau, die, ihrer stolzen Natur entsprechend, während des ganzen Krieges die ihr von Freunden angebotene Hilfe zurückgewiesen hatte. In Uttwil war alles anders. Wir waren im Dorf wohlgelitten, die Kinder erholten sich rasch, und meine Frau genoß die Natürlichkeit, in der sich alles abspielte. Als erste von meinen Freunden ließen sich die Schickeles in Uttwil nieder. Ihnen folgte der Dramatiker Carl Sternheim mit Frau und Kindern; er fand ein Haus, in dem er seine Bibliothek und seine Gemäldesammlung unterbringen konnte, in der sich zwei van Goghs und Meisterwerke des französischen Impressionismus befanden. Annette Kolb richtete sich in dem einfachen, aber sehr gepflegten Gasthaus im Zentrum des Dorfes ein, wo sich auch der Berliner Dirigent Oskar Fried niederließ, der während des Krieges in Bern erfolgreiche Konzerte mit Werken von Berlioz, Tschaikowsky und vor allem von Gustav Mahler geleitet hatte. Mir fehlte nur noch ein Kreis von begeisterten jungen Schülern, mit denen ich die Fortführung meiner Mission und neue Aufgaben hätte vorbereiten können. Unser Haus war größer, als es mir anfänglich schien, und eignete sich vorzüglich für die Einrichtung von Ateliers. Im ersten Stock befand sich ein großer Raum, der uns als ‘living-room’ diente, aber zugleich für Vorträge und zur Unterbringung der Bibliothek geeignet war. Hier fand auch der große Blüthner-Flügel seinen Platz, der uns von Uccle nach Berlin und von dort nach Weimar begleitet hatte. Seit der Zeit, als wir das Haus ‘Bloemenwerf’ bezogen hatten, bis jetzt | |
[pagina 408]
| |
war ich dank meiner Arbeit materiell unabhängig und konnte mühelos für meine Familie sorgen. Auch jetzt schien mir alles in Ordnung zu sein. Ich verfügte noch über ein paar tausend Schweizer Franken und hatte mein Bankkonto in Weimar, auf dem auch der Betrag für den Verkauf des Hauses ‘Hohe Pappeln’ stand. Aber die Wirklichkeit sah ganz anders aus. Nach dem Friedensschluß in Versailles (28. Juni 1919) entschloß ich mich, nach Weimar zu gehen, um unsre Möbel, die Bücher und Kunstgegenstände aus unserem Haus und die Skizzen, Pläne und Modelle aus meinem Atelier in der Kunstschule und dem Gartenatelier in Ehringsdorf nach Uttwil spedieren zu lassen. Beim ersten Besuch in meiner Weimarer Bank, wo ich feststellen wollte, welche Mittel mir für die Verwirklichung meiner Pläne in Uttwil zur Verfügung standen, erfuhr ich, daß alle meine Guthaben von der neuen Regierung in Sachsen-Weimar gesperrt worden waren. Dieser Schlag traf mich ebenso unerwartet und ebenso brutal wie der Kriegsausbruch im August 1914, als mir alles zertrümmert wurde. Ich fragte mich, wem ich mich anvertrauen, an wen ich mich wenden könnte. Aber ich hatte wenig Zeit nachzudenken. Das Verpacken meiner Sachen, bei dem mir Hugo Westberg half, nahm mich voll in Anspruch. Unsere Arbeit glich der von Sanitätern, die die Leichen auf einem Schlachtfeld sammeln. Wir hatten das Gefühl, das Ergebnis von vierzehn Jahren schöpferischer Arbeit in Kisten zu verpacken. Westberg, der die Kisten zunagelte, nahm schweigend an meinen Qualen teil. Ein Erlebnis lenkte mich von meinen schweren Gedanken ab. Ich wohnte einer Sitzung des ersten deutschen republikanischen Parlaments bei. Das Parterre und die Bühne des Weimarer ‘Hoftheaters’ waren von der Regierung und den Abgeordneten besetzt. Auf den Balkonen befand sich das Publikum. In einer vergitterten Loge nahm ich an der denkwürdigen Verhandlung teil, bei der Matthias Erzberger die frühere kaiserliche Regierung anklagte, seit 1916 alle Friedensmöglichkeiten versäumt zu haben. Mit erhobener Stimme und unwiderstehlichem Nachdruck verwünschte er das frühere Regime und seine servilen Diener. Als er die Tribüne verließ, hatten die Mitglieder der neuen Regierung, die Parlamentarier und alle Anwesenden das Gefühl, daß sich Erzberger sein eigenes Todesurteil gesprochen hatte. Die Bestürzung war allgemein. Der Mut und die Entschlos- | |
[pagina 409]
| |
senheit, vor nichts zurückzuscheuen, hatten ein tödliches Schweigen der Zuhörer zur Folge. Die spätere Ermordung Erzbergers war die Bestätigung des damaligen Eindrucks. Die Stunden in Ehringsdorf strengten mich ungemein an; gelegentlich war ich wie geistesabwesend. So erging es mir auch an jenem Tag, als wir an der letzten Kiste arbeiteten. Ich hatte das Rufen und Winken des alten Briefträgers nicht bemerkt, der uns früher in Ehringsdorf morgens und abends die zahlreiche Post brachte. Jetzt rief er mich über die Hecke hinweg an: ‘Herr Professor, endlich habe ich Sie gefunden. Seit drei Tagen trage ich einen Brief für Sie herum, und niemand im Dorf kann mir Ihre Adresse geben oder sagen, wo Sie hausen!’ Mit tausend Fragen nach meiner Gesundheit, meiner Familie und vielen anderen Dingen gab er mir einen Brief, auf dessen Kuvert sich die Adresse einer holländischen Baufirma befand. Ich dankte dem Briefträger herzlich und steckte den Brief in die Tasche. Weder Westberg noch ich dachten tagsüber an diesen Brief. Erst am Abend im ‘Russischen Hof’, wo ich wohnte, fragte mich Westberg, ob ich den Brief gelesen hätte. Jetzt nahm ich ihn zur Hand. Auf dem Kuvert stand: W. Offerhaus, Material und Konstruktion, Rotterdam. Beim Lesen wurde ich neugierig: Offerhaus teilte mir mit, daß er von einem in Holland hochangesehenen Ehepaar den Auftrag erhalten hätte, meine Adresse ausfindig zu machen. Er habe den Brief, der ein Treffen vorschlug, auf gut Glück an meine alte Adresse in Weimar gerichtet in der Hoffnung, daß er mich dort erreichte. Er selbst sei in Düsseldorf, wo er bis zu einem bestimmten Tag meine Nachricht erwarte. Der angegebene Tag war ausgerechnet der heutige. Ich bat Hugo Westberg, ein dringendes Telefongespräch anzumelden. Glücklicherweise erreichte er Herrn Offerhaus, der sich bereit erklärte, seine Rückreise nach Rotterdam zu verschieben, wenn ich tags darauf in Düsseldorf sein könnte. Wir hatten also keine Eile, vom Essen aufzubrechen, und gingen an eine zweite Flasche ‘Liebfrauenmilch’, die der Kellner in den eisgekühlten Korb legte. Bei der Besprechung, die ich am nächsten Tag in Düsseldorf mit Herrn Offerhaus führte, klärte er mich darüber auf, daß es sich bei den Mäzenen um A.G. Kröller und seine Frau handelte, deren Sammlung damals schon weltberühmt war. Er fügte hinzu, daß die Kröllers sich mit großen | |
[pagina 410]
| |
Plänen beschäftigten, zu deren Ausführung die notwendigen Mittel zur Verfügung ständen, und daß er von einer raschen Antwort des Herrn Kröller an mich überzeugt sei. Ich war mir sofort darüber klar, daß jedes Angebot der Mäzene in Den Haag für mich von größter Bedeutung sein konnte. Offerhaus fuhr nach Rotterdam; mich drängte es, so rasch wie möglich nach Uttwil heimzukehren. In Uttwil erzählte ich meiner Frau, was ich in Weimar erfahren und was mir Herr Offerhaus mitgeteilt hatte. Was immer mit unserem blokkierten Vermögen geschehen würde: der Traum der Gründung eines Institutes mit Werkstätten war ausgeträumt. Die Frage einer Zusammenarbeit mit dem Ehepaar Kröller machte keine überstürzten Entscheidungen notwendig. So entschlossen wir uns, unseren Kindern noch nichts von einem unter Umständen bevorstehenden erneuten Wohnortwechsel zu sagen. Das Glück der Kinder lag mir vor allem am Herzen. Sie durchstreiften mit den Kindern unserer Freunde das Land und verbrachten den halben Tag im Badekostüm. Der Höhepunkt war die Mittagsstunde, zu der sich alle Mitglieder unserer jungen Kolonie nach getaner Arbeit in unserem Garten trafen. Wie auf Befehl stand auf jedem der Pfeiler des verfallenen Landungssteges ein junges Wesen. Sie schrien wie die Wilden, stürzten sich ins Wasser, tauchten, schwammen, entstiegen dem See, um das Spiel von neuem zu beginnen; an der Spitze meine Tochter Anne, die immer auf den höchsten Pfeiler kletterte und als Meisterin im Tauchen galt. Soviel Freude und Sorglosigkeit halfen mir, meine Sorgen zu verscheuchen, die mich in den Nächten plagten. Unterdessen waren die Würfel schon gefallen, aber noch immer mußte ich warten. Erst später erfuhr ich die Gründe für die verspätete Antwort des Ehepaars Kröller. Meine Nervosität hatte einen Grad erreicht, daß jedes ungeschickte Wort, jede unbewußte Anspielung mein Vertrauen in die Zukunft erschütterten. Der Brief, der endlich aus Den Haag ankam, war weder von Herrn noch von Frau Kröller unterzeichnet. Er war von H.P. Bremmer geschrieben, mit dem ich mich in den neunziger Jahren angefreundet hatte, als er und ich als Maler an den fortschrittlichen Kunstausstellungen in Brüssel und Den Haag teilnahmen. Auf seine Anregung hin hatten wir auf unsrer Hochzeitsreise Madame Théo van Gogh besucht. In meinen Weimarer Jahren vor dem Krieg war unsre Verbindung lockerer | |
[pagina 411]
| |
geworden, aber nicht abgerissen. Herr und Frau Kröller ließen mich durch ihn zu einem Besuch in Den Haag bitten, um die Bedingungen zu besprechen, zu denen ich unter Umständen bereit wäre, in ihre Dienste zu treten. |
|

