Geschichte meines Lebens
(1962)–Henry Van de Velde–
[pagina 322]
| |
Elftes Kapitel
| |
Weltausstellung Brüssel 1910Im Zusammenhang mit der Brüsseler Weltausstellung von 1910 enthüllte sich nun plötzlich das Ergebnis meiner zehnjährigen, unablässigen Arbeit, das Resultat der harten Kämpfe des aus Belgien stammenden Ausländers, | |
[pagina 323]
| |
der schöpferisch und pädagogisch in Deutschland tätig war. Deutschland erschien mit seinen kunstgewerblichen Produkten an der Spitze der Länder, die an Stelle der stil-imitatorischen Erziehung neue, gesunde Prinzipien gesetzt und die Flut der überladenen, abgebrauchten und nur auf Neuigkeitssensation gerichteten kunsthandwerklichen und kunstindustriellen Produktion eingedämmt hatten. Die Brüsseler Weltausstellung vermittelte ein eindrucksvolles Bild dieser Situation, in der Deutschland und Österreich die Aufmerksamkeit auf sich zogen. Der deutsche Beitrag war geradezu eine Offenbarung. Das Aufsehen, das dieser schon bei der Eröffnung der Ausstellung erregte, ließ in der Folge nicht nach. Die belgische öffentliche Meinung lobte einstimmig die vorzügliche Ausführung der Möbel und anderer Einrichtungsgegenstände sowie der Produkte des Kunstgewerbes und der Kunstindustrie. Bei den ausländischen Besuchern erregte die hohe Qualität des deutschen Ausstellungsgutes nicht geringere Bewunderung. Man interessierte sich brennend dafür, welche Art revolutionärer Initiative und Aktion eine Entwicklung ausgelöst hatte, die Deutschland mit einem Schlag an die Spitze der teilnehmenden Nationen brachte. Das belgische Publikum war überrascht - und stolz, als es sich herausstellte, daß Deutschland unter der Führung eines belgischen Künstlers zu neuen, vernunftgemäß konzipierten Formen und Ornamenten gelangt war. Der deutsche Kritiker Karl Scheffler erinnerte im Vorwort des offiziellen Katalogs daran, daß die neue künstlerische Richtung in Deutschland die Weiterentwicklung jener Revolte bedeutete, die rund fünfzehn Jahre zuvor von belgischen Pionieren ausgelöst worden war. ‘Kein deutscher Kunsthandwerker’, stellte Scheffler fest, ‘kann diese Weltausstellung besuchen, ohne sich an die früher so häufig erwähnten Namen von Lemmen, Finch, Serrurier-Bovy oder Horta zu erinnern. Der Mann jedoch, an den wir in Brüssel am meisten denken, ist jener Belgier, der seit zehn Jahren Deutschland zum Schauplatz seines Lebens und Schaffens gemacht und in dem unsre Kunstindustrie einen hervorragenden Inspirator gefunden hat, dessen aufopfernde Tätigkeit viel umstritten worden ist und dessen Arbeit der deutschen Kunstindustrie eine bisher unbekannte Kraft einflößt: Henry van de Velde. Es ist ein charakteristisches Zeichen der Situation, daß dieser Künstler, | |
[pagina 324]
| |
wenn er seinem Rang entsprechend in der Ausstellung vertreten gewesen wäre, sich mit einiger Verlegenheit hätte fragen müssen, ob er zur belgischen oder deutschen Abteilung gehöre. In Belgien ist er geboren und erzogen worden, Belgien hat ihm den revolutionären Willen und auch die Tradition gegeben; Deutschland ist seine zweite Heimat geworden und hat ihm ein Tätigkeitsfeld eröffnet; in Deutschland hat er Resonanz und begeisterte Schüler gefunden. In van de Veldes Namen vereinigt sich der deutsche und der belgische Genius. Sein Schaffen bedeutet für uns ein Symbol der Synthese germanischer und romanischer Art, wie alle großen geistigen und künstlerischen Leistungen Belgiens.’ Die Brüsseler Weltausstellung hätte für Belgien segensreiche Folgen haben können, wenn die Regierung der Forderung des bedeutendsten belgischen Kunstkritikers jener Zeit, Fierens-Gevaert, der der Vater des späteren Direktors des Brüsseler Nationalmuseums war, einige Aufmerksamkeit geschenkt hätte: ‘Als Sühnemaßnahme verlangen wir die sofortige Organisation einer Ausstellung, die der heutigen Wiedergeburt von Kunstgewerbe und Kunstindustrie gewidmet ist.’ Knapper und unbarmherziger konnte der Bankerott Belgiens nicht bezeichnet werden, der sich bis zum Jahr 1937 hinzog, als sich Belgien anläßlich der Pariser Weltausstellung mit einem Schlag erholte. König Albert I. geruhte, mir das Ritterkreuz des Leopold-Ordens in jenem Augenblick zu verleihen, in dem die Dienste, die ich Deutschland geleistet hatte, außerordentliches Aufsehen erregt hatten. Diese ungewöhnliche Auszeichnung, die mir auf dem Höhepunkt der Brüsseler Ausstellung zuteil wurde, war der Ausdruck einer persönlichen Stellungnahme des Königs, die den leitenden Persönlichkeiten der belgischen Kunstverwaltung hätte zu denken geben müssen. In meinem Dankschreiben an König Albert I. gestattete ich mir darauf hinzuweisen, ‘daß ich, wenn auch nicht der einzige Pionier der Wiedergeburt der Künste auf dem Kontinent, so doch zweifellos der einzige gewesen bin, der seine Aktivität, sein Schaffen und sein Apostolat mit dem Exil hatte bezahlen müssen’. Ich machte den König auf die Gründung der einflußreichen Organisation des Deutschen Werkbundes aufmerksam und erlaubte mir hinzuzufügen, daß nur eine Vereinigung, die Architekten, Ingenieure, Kunsthandwerker und die Spitzen der Kunstindustrie als begeisterte Anhänger der neuen Prin- | |
[pagina 325]
| |
zipien umfaßte, den Verfall des Geschmacks und der Produktion aufhalten und Belgien den verlorenen Ruf und die in der Folge verlorenen Absatzmärkte wiedergewinnen könnte. ‘Die von Deutschland errungenen Erfolge lassen keinen Zweifel über die erforderliche Art des Vorgehens. Aber ich würde meine Gedanken nur unvollständig ausdrücken, wenn ich nicht meiner Überzeugung Ausdruck verliehe, daß auch die methodischste, bestüberlegte Organisation aller Faktoren der Wiedergeburt der Architektur und Kunstindustrie nur dann zur höchsten Wirkung gelangen kann, wenn der Souverän nicht gleichgültig bleibt. Wenn er sein persönliches Interesse nicht kundtut, wenn er nicht von den seinem Rang entsprechenden Vorrechten Gebrauch macht, wie dies in den großen Zeiten der Antike, des Mittelalters und der Renaissance der Fall gewesen ist, dann ist alle Bemühung umsonst. Sire, auf dem Gebiet der Künste und des Geschmacks sind die Völker weniger mißtrauisch als auf den Gebieten der Politik und der Verwaltung. Sie sind bereit, sich mit betonter Bereitwilligkeit dem Geschmack ihrer Herrscher anzuschließen.’ Diese Worte richtete ich an König Albert, als ich von der Haltung des Großherzogs Wilhelm Ernst aufs tiefste enttäuscht war. Ich fühlte ein Nachlassen meiner Begeisterung und meines Arbeitseifers und empfand zum ersten Male nach so vielen Jahren der Abwesenheit von Belgien das Gefühl von Heimweh. Es überkam mich ein gewisser Überdruß, mich bei jeder Gelegenheit als Ausländer verteidigen zu müssen. | |
Das Pastorat in RigaIm gleichen Jahr 1910 erhielt ich eine Einladung zur Beteiligung an einem engeren Wettbewerb für ein Pastorat in Riga. Drei Architekten waren aufgefordert worden: ein Vertreter der neuen Wiener Schule, ein Architekt aus Riga und ich. Der Auftrag war sehr reizvoll: drei Pfarrerwohnungen, mehrere Säle und andere Räume für kulturelle Veranstaltungen. Auch das für die Vorprojekte angesetzte Honorar war verlockend. Die Möglichkeit, mein Tätigkeitsfeld bis nach Rußland auszubreiten, bestimmte mich zur Annahme | |
[pagina 326]
| |
des Angebots. Auf Grund meines Entwurfs wurde mir der Bau des Pastorats übertragen, und ich wurde eingeladen, nach Riga zu kommen. Auf meinen wiederholten Reisen, die mich im Schlafwagen von Weimar nach der Hauptstadt Lettlands führten, war ich beim morgendlichen Erwachen stets tief von der Trostlosigkeit der weiten litauischen Ebenen beeindruckt. Ich brauchte Stunden in den belebten Straßen Rigas oder in den luxuriösen Empiresalons meines Hotels, um mich vom Bild der Verlassenheit, des Elends und der stummen Anklage dieser Landschaft zu befreien. In allen anderen ebenen Landstrichen gibt es irgendwelche greifbaren Formen oder wenigstens verschwimmende Linien. Hier gab es nichts; nichts als Unendlichkeit und Leere. Nur einige Strohdächer ragten aus der nackten Ebene, unter denen sich kleine Bauernhöfe duckten, die voneinander weit entfernt lagen. Mensch und Tier lebten unter dem gleichen Dach. Dort lebt man, dort stirbt man, dort bearbeitet man verzweifelt die Scholle, verfolgt von der Furcht vor Hunger, vor dem Teufel und dem Grundbesitzer. Das Ackergerät, das diese Menschen benutzten, hat sich seit urdenklichen Zeiten kaum geändert. Ein Bild des Elends, der Not und des Schreckens, dem ich mich hätte entziehen können, wenn ich eine Stunde länger geschlafen hätte. War ich dann in Riga, nahm ich - so scheint es mir heute - an einer ununterbrochenen Kette von Festlichkeiten teil, bei denen die alten Gilden, Klubs und andere Gesellschaften sowie private Kreise sich überboten. Jedes Vorstandsmitglied des Pastorats gehörte zu irgendeiner dieser Vereinigungen und machte sich ein Vergnügen daraus, mich in den Kreis seiner Freunde einzuführen und zu den Liebesmählern mitzunehmen. Der Schmaus war üppig, und der Luxus von Tisch und Tischgerät übertraf an Pracht bei weitem alles, was ich am Weimarer Hof, in fürstlichen Häusern der Aristokratie und der Hochfinanz in Deutschland gesehen hatte. Die Tafeln waren überfüllt mit den wertvollen Schätzen der Gilden und Klubs, unerschöpflichen, gigantischen Füllhörnern gleich, wie man sie bei Fest- oder Karnevalszügen sehen kann: Goldschmiedearbeiten, die von einer entfesselten Phantasie erfunden und von virtuosen Händen ausgeführt waren, extravagantes, allegorisches Porzellan, Platten und Teller mit mächtigen, geradezu wollüstigen orientalischen Ornamenten oder unschuldigen, sentimentalen Blümchen verziert, wildgeschwungene Suppen- und Gemüseschüsseln, ge- | |
[pagina 327]
| |
schliffene Vasen und Weingläser, Besteck, das von reliefiertem Zierat überladen war. Ich hätte gegen all diesen falschen Pomp, den ich in meinen Schriften anprangerte und in meinen Vorträgen lächerlich machte, revoltieren müssen. Jedoch meine Niedertracht, ‘Gourmandise’ und der Duft der Speisen und Weine umnebelten mein Bewußtsein, und ich überließ mich der teuflischen Versuchung. Glücklicherweise habe ich auch weniger schwüle Erinnerungen an meine Aufenthalte in Riga. Vor allem befriedigte mich der Kontakt mit den lettischen Handwerkern der verschiedenen Zweige, die sich durch intime Materialverbundenheit und eine logische und intuitive Beziehung zu ihren Werkzeugen auszeichneten. Damals wurde der ganze Bau noch von Hand errichtet. Die Mischmaschine, die für das Zementfundament des Pastorats gebraucht wurde, trat zum ersten Male auf einem lettischen Bauplatz in Erscheinung. In Riga waren bisher alle Gebäude auf Pfählen errichtet. Für meinen Bau empfahlen die einheimischen Unternehmer die Kombination beider Methoden: also ein Zementfundament auf Pfählen. Heute noch sehe ich die arbeitenden Zimmerleute vor mir, die als einzige Werkzeuge Säge und Axt verwendeten. Besonders die Geschicklichkeit, mit der sie die Axt handhabten, ist mir als eindrucksvolles Schauspiel in lebhafter Erinnerung geblieben. Das Pastorat lag an einer der engen Hauptstraßen Rigas und erstreckte sich über eine Front von etwa fünfzig Metern. Im Sommer 1912 wurde es fertig. Zu dieser Zeit verfügte ich in Paris über ein Atelier und eine Wohnung, die ich mir eingerichtet hatte, nachdem ich mit der Ausführung der Pläne für das ‘Théâtre des Champs-Elysées’ beauftragt worden war. | |
‘Théâtre des Champs-Elysées’ in ParisKurz nachdem ich von meinem ersten Besuch in Riga nach Weimar zurückgekehrt war, besuchte mich der Maler Maurice Denis, mit dem ich mich während meiner verschiedenen Pariser Aufenthalte angefreundet hatte. Maurice Denis, der unsere Bestrebungen in Weimar aufmerksam verfolgte, interessierte sich besonders für meine Theaterstudien, bei denen ich auf | |
[pagina 328]
| |
einen Zuschauerraum und eine Bühne zielte, die den total neuen Anforderungen zu entsprechen suchten, die das Publikum des 20. Jahrhunderts an das Theater stellte. Eine Gruppe von Pariser Persönlichkeiten plante die Errichtung eines Theaters, das unter der Leitung des international hochgeschätzten Managers Gabriel Astruc nicht nur durch außergewöhnliche Vorstellungen und Konzerte, sondern auch durch seine neuartige architektonische und dekorative Gestaltung die europäischen und amerikanischen Theater- und Musikfreunde anziehen sollte. Denis war mit Astruc befreundet. Präsident der Gesellschaft war Gabriel Thomas. Die Liste der Aktionäre vereinigte Fürsten, Aristokraten, Künstler und Persönlichkeiten der internationalen Hochfinanz. Auf der Liste der Förderer des geplanten Pariser Theaters figurierte an der Spitze Königin Elisabeth von Belgien. Der Entwurf der Pläne war dem Architekten Roger Bouvard übertragen worden, der jedoch keine Lösung gefunden hatte, die den Wünschen der maßgebenden Persönlichkeiten entsprach. Die Leitung der Gesellschaft ‘Théâtre des Champs-Elysées’ hatte Maurice Denis beauftragt, sich genau über meine Theaterbauideen, meine technischen Studien und meine Beziehungen zu Max Reinhardt und Gordon Craig zu informieren und festzustellen, in welcher Weise ich am Bau des Theaters mitarbeiten könnte. Denis war an dem Projekt besonders interessiert, weil er den Auftrag für die Deckengemälde im Zuschauerraum erhalten hatte. Für die dekorative Ausgestaltung der Fassade war der Bildhauer Antoine Bourdelle vorgesehen. Das neue Theater sollte an der Avenue des Champs-Elysées errichtet werden. Der Plan scheiterte aber am Einspruch des Pariser Stadtarchitekten, der die weitsichtige Entscheidung getroffen hatte, die Avenue des Champs-Elysées vor der Überflutung durch Varietés, Filmtheater und Restaurants, eines häßlicher und banaler als das andere, zu bewahren. Roger Bouvard war der Sohn des Stadtarchitekten. Die Auftragserteilung an Bouvard erschien der Gesellschaft als einzige Möglichkeit, den Bau des Theaters bewilligt zu erhalten. Nach den beiden Enttäuschungen - Widerstand des Stadtarchitekten und unbefriedigende Entwürfe seines Sohnes Roger Bouvard - erwarb die Gesellschaft ein Terrain an der Avenue Montaigne. Trotzdem behielt das entstehende Theater den Namen ‘Théâtre des Champs-Elysées’. | |
[pagina *53]
| |
 | |
[pagina *54]
| |

97 Henry van de Velde mit seinem Sohn Thyl
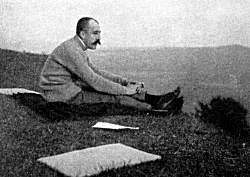
98 Henry van de Velde im Gebirge
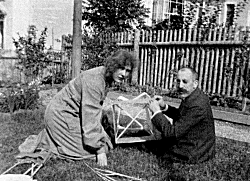
99 Erica von Scheel und Henry van de Velde, um 1906
| |
[pagina *55]
| |

100 Leder-Bucheinband ‘Also sprach Zarathustra’, Insel-Verlag, Leipzig, 1908
| |
[pagina *56]
| |
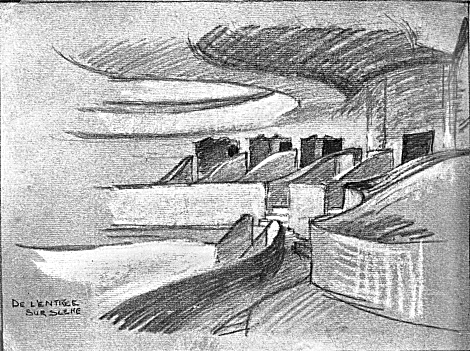
101 Skizze zum ‘Théâtre des Champs-Elysées’ in Paris, 1911
| |
[pagina 329]
| |
Bevor ich der Einladung nach Paris folgte, verlangte ich eine schriftliche Erklärung des Präsidenten der Gesellschaft, daß Roger Bouvard mit meiner Mitarbeit und mit der Ausführung neuer Pläne auf Grund neuer Studien einverstanden wäre. Die Chance, ein großes Theater zu bauen, lockte mich unwiderstehlich, nachdem zwei Möglichkeiten in Weimar fehlgeschlagen waren und sonst keine Aussicht bestand, meine Pläne und Modelle für ein Theater des neuen psychologischen Dramas zu verwirklichen. Trotzdem muß ich sagen, daß ich ohne mein Zutun, ja fast gegen meinen Willen zur Mitarbeit an dem Pariser Projekt veranlaßt wurde. Es sollte in einem Land verwirklicht werden, von dem ich annehmen mußte, daß es weit davon entfernt war, meine Ideen und Neuerungen zu akzeptieren. In dieser Situation begab ich mich auf Einladung von Gabriel Thomas nach Paris. Ich war nach Lage der Dinge eher mißtrauisch. Aber die offene, korrekte und freundschaftliche Art, mit der ich empfangen wurde, ließ meine Befürchtungen schwinden. Gabriel Thomas entwickelte mir sein Programm und die Bedingungen, unter denen ich mit Roger Bouvard zusammenarbeiten sollte. Ich verlange von meinem Mitarbeiter nicht mehr und nicht weniger, bemerkte ich Monsieur Thomas gegenüber, als daß er die von mir entworfenen Pläne unterschreibe. Andrerseits bat ich, unverzüglich den Ingenieur zu bestimmen, der als weiterer Mitarbeiter zugezogen werden mußte. Gabriel Thomas beruhigte mich. Was meine Forderungen in bezug auf Roger Bouvard betraf, so entsprachen sie genau dessen eigenen Wünschen. Daher unterzeichnete ich am 3. Dezember 1910 den Vertrag mit der ‘Société du Théâtre des Champs-Elysées’. Mein Ehrgeiz wurde dadurch begrenzt, daß ich offiziell die Rolle des beratenden Architekten spielte. In Wirklichkeit war ich Autor der Pläne, die nur der Billigung durch den Präsidenten des Verwaltungsrates bedurften. Ich übernahm die Verantwortung für den Entwurf und die Ausführung dieser Pläne. Erleichtert war ich, als ich am nächsten Tag meinen Kollegen Bouvard in seiner luxuriösen Wohnung an der Place de la Concorde aufsuchte. Während unseres Gespräches hatte ich keinen Augenblick den Eindruck, mit einem Künstler, einem Architekten zu verhandeln, viel eher mit einem Verwaltungsrat oder einem Bankdirektor. Aus seinen Worten und in sei- | |
[pagina 330]
| |
nem Verhalten war nicht das geringste künstlerische Interesse zu verspüren. Der Vorschlag, der ihm gemacht worden war, änderte zwar seine Beziehungen zur ‘Société du Théâtre des Champs-Elysées’, aber die Sache blieb, was sie von Anfang an für ihn gewesen war: ein Geschäft. Die von mir vorgesehene Art der ‘Zusammenarbeit’ empfand er in keiner Weise als unwürdig; er erklärte sich bereit, sie bedingungslos anzunehmen. So hatte ich nur noch mit dem von der Gesellschaft ernannten Ingenieur Milon Verbindung aufzunehmen. Er empfing mich in seinem Büro in einem der Räume des Eiffelturmes. Milon war Eiffels rechte Hand beim Bau des Turmes gewesen. Wir verstanden uns ausgezeichnet. Die gegenseitige Achtung und das Vertrauen, das wir bei diesem ersten Zusammentreffen empfanden, wurden zum Fundament unserer Zusammenarbeit. Nachdem ich über die wichtigsten Punkte des Planes durch Gabriel Thomas unterrichtet war, machte ich die definitive Annahme nur noch davon abhängig, daß ich in Weimar die notwendigen Dispositionen treffen könnte, damit mein Seminar und die Schule nicht vernachlässigt wurden. Dann nahm ich den nächsten Schnellzug, der von Paris über Berlin nach Riga fuhr. Ich machte mir keinen Augenblick Gedanken darüber, ob meine Kräfte ausreichen würden, zwei so große Aufgaben wie das Pastorat in Riga und das ‘Théâtre des Champs-Elysées’ zu bewältigen, obwohl zur gleichen Zeit noch andere Projekte in Arbeit waren: die Villa Golubeff in Fontainebleau, das Nietzsche-Stadion in Weimar und ein Museum in Erfurt. In der Rue Boccador, in unmittelbarer Nähe des für das Pariser Theater bestimmten Bauplatzes, mietete ich eine möblierte Wohnung mit einem großen Atelier. Von den Hinterfenstern aus konnte man auf die Avenue Montaigne sehen. Maurice Denis empfahl mir einen jungen französischen Architekten, der gerade die Ecole des Beaux Arts absolviert hatte; sein eigentliches Interesse galt jedoch der modernen Kunst. Er hieß Marcel Guilleminault. Ich sah sofort, daß er eine leidenschaftliche Künstlernatur und sowohl als Maler wie als Architekt sehr begabt war. Sein Wesen war offen, gerade und verläßlich und zeichnete sich durch außergewöhnliche geistige Bildung und eine Sensibilität aus, die auf die kleinsten Nuancen und Feinheiten linearer Formen reagierte. Von Anfang an stürzte er sich auf die Ausarbeitung der Skizzen, die ich aus Weimar mitbrachte. Während unserer Zusammenarbeit war er mit Begeisterung und Hingabe für mich tätig. | |
[pagina 331]
| |
Bevor ich mich mit Guilleminault und Milon zur Besprechung meines Vorentwurfes zusammensetzte, hielt ich es für richtig, zusammen mit Milon auf einer Studienreise durch Deutschland die Fortschritte zu studieren, die bei der Anlage der Zuschauerräume und der technischen Ausrüstung der Bühnen gemacht worden waren. Milon, der sich bisher nur auf die technischen Einrichtungen der ‘Großen Oper’ in Paris hatte stützen können, fand Gelegenheit, auf unserer gemeinsamen Reise das Münchner Prinzregententheater, den jüngeren Bruder des Bayreuther Festspielhauses, und einige andere neue Theater kennenzulernen. Im Rheinland, im Ruhrgebiet und in Westfalen waren während der Gründerjahre die Theater wie Pilze nach einem Gewitter aus dem Boden geschossen. Jede Stadt von achtzigtausend Einwohnern glaubte, ein neues Theater errichten zu müssen, dessen Ausführung entweder einem lokalen Architekten oder einer der spezialisierten großen deutschen oder österreichischen Baufirmen übertragen wurde. Es entstand ein Wettstreit in bezug auf raffinierte technische Ausrüstung der Bühnen. Die Drehbühnen, Schiebebühnen, halbkreisförmigen Bühnenhorizonte und zahllose Erfindungen auf dem Gebiet der Beleuchtung und Projektion stammen aus diesen Jahren. Nach unserer Rückkehr setzten wir uns zu dritt an die Arbeit, Milon, Guilleminault und ich. Eigentlich zu viert. Denn jeden Tag erschien auch Gabriel Thomas in meinem Atelier und setzte uns auseinander, wie ein Zuschauerraum für das Pariser Publikum beschaffen sein müsse. In jeder dieser täglichen Sitzungen versicherte er, daß das französische Publikum keine andere Form des Zuschauerraumes akzeptiere als den Typus italienischer Tradition, der das gesellschaftliche, das mondäne Element eines Theaterabends betonte. Das französische Publikum, wiederholte Thomas immer wieder, wolle in erster Linie im Theater gesehen werden; er gab zu, daß dadurch ein großer Teil der Zuschauer einer guten Sicht auf die Bühne beraubt würde. Unsere Überzeugung war der seinen diametral entgegengesetzt. Wir verlangten eine Zusammenfassung der Zuschauer und die Konzentration der Blickrichtung auf die Bühne. Alle, die Vertreter der privilegierten Klasse wie die bescheideneren Besucher, sollten in gleicher Weise den szenischen Vorgängen folgen können. Monatelang spielte Monsieur Thomas die Rolle des weitblickenden Moderators, der zwischen beiden Auffassungen ver- | |
[pagina 332]
| |
mittelte. Er war sich klar darüber, wie schwer mir die verlangten Konzessionen fielen und welche Anstrengungen es mich kostete, zu einer Form des Saales zu gelangen, die einerseits den Gewohnheiten des Pariser Publikums entgegenkam und andrerseits einen Fortschritt gegenüber der üblichen Form bedeutete, deren Hauptfehler darin bestand, daß ein Teil der Zuschauer wenig oder fast gar nichts von der Bühne sehen konnte. Ingenieur Milon sah für den Zuschauerraum natürlich ein Eisenskelett vor. In den Jahren seiner Zusammenarbeit mit Eiffel war er zur Überzeugung gelangt, daß die Eisenkonstruktion jeder anderen überlegen sei. Ich hegte in dieser Hinsicht keinen Zweifel bis zu dem Tag, an dem er mir die Kosten für den Rohbau vorlegte. Ende März 1911 konnte ich Gabriel Thomas die Pläne unterbreiten, die von Roger Bouvard und Henry van de Velde unterzeichnet waren. In weniger als vier Monaten hatten wir dank der unablässigen Arbeit Milons und Guilleminaults das Kunststück fertiggebracht, den in Auftrag gegebenen Entwurf zu schaffen: einen Zuschauerraum für achtzehnhundert Personen, eine Bühne für große Opern- und Schauspielaufführungen mit allen technischen Einrichtungen, Magazine, Garderoben für die Schauspieler, eine Bar und ein Foyer. Weiterhin einen zweiten Theatersaal für kleine Schauspielaufführungen und einen Ausstellungsraum mit eigenem Zugang und eigenen Treppen. Das Terrain war offensichtlich zu klein für ein solches Programm. Nur der große Zuschauerraum, die Eingangshalle, die Galerien und die geräumigen Treppen hatten genügende Dimensionen, die den Eindruck einer gewissen Festlichkeit und Monumentalität hervorrufen konnten. Nachdem Monsieur Thomas die von Marcel Guilleminault ins Reine gezeichneten Skizzen in Händen hatte, rief er die Herren des Verwaltungsrates der Gesellschaft zusammen. Die Sitzung fand im Hause einer titelreichen Persönlichkeit - zumindest eines Grafen - unbestimmter Nationalität statt. In der großen Eingangshalle seiner Villa hing sein lebensgroßes Porträt als päpstlicher Kammerherr. Eine monumentale Treppe führte zum Salon, in dem sich die Mitglieder des Komitees versammelten. Die Pläne und die perspektivischen Skizzen Guilleminaults wurden geprüft. Roger Bouvard war nicht erschienen. Die Zusammenkunft wäre reibungslos verlaufen, wenn ich nicht ernste Einwände gegen die Wahl des Terrains | |
[pagina 333]
| |
erhoben hätte, das für das überladene Bauprogramm nicht ausreichte. Sehr geschickt wich Präsident Thomas einer Diskussion über diesen Punkt aus. Er richtete einige liebenswürdige Worte an mich und lobte das Vorprojekt, das einige Klippen überwunden hätte und den Ansprüchen des französischen Publikums auch in gesellschaftlicher Hinsicht Rechnung trage. Die Anerkennung, die mir Gabriel Thomas zollte, war aufrichtig gemeint. Auf ein großes Foyer, den zweitwichtigsten Ort des italienischen Theatertypus, wo sich die Besucher sehen lassen und während der Pausen unterhalten können, mußte ich aus Mangel an Platz verzichten. Ich versuchte, es durch weite Wandelgänge und eine Folge von Galerien zu ersetzen, die mit der Eingangshalle in Verbindung standen. Die für offizielle Persönlichkeiten bestimmten Proszeniumslogen ließ ich weg. An ihrer Stelle sah ich an den beiden Enden der den Zuschauerraum umfassenden Rundgalerien weit vorgezogene, offene Loggien vor, in denen die Besucher während der Pausen promenieren und von wo sie in den Zuschauerraum sehen konnten. Ich erwartete von dieser Neuerung eine vorteilhafte räumliche und psychologische Bindung zwischen Saal und Galerien, die den Verzicht auf eine gewisse Zahl von Sitzen rechtfertigte, die ohnehin schlechte Sicht gehabt hätten. Die runden Linien der Balkone besaßen im Entwurf ausdrucksvolle Spannung. Sie schlossen sich unmittelbar an die die Kuppeldecke tragenden Stützen an. Monsieur Thomas war von der eleganten Lösung dieser Neuerung entzückt. Die Salons, die Bar, die Galerien bildeten ein organisches Ganzes, das, wenn auch nicht klassisch in der Form, den praktischen Ansprüchen, ‘dem kollektiven wie dem individuellen Wohlgefühl des französischen Publikums’ - wie ein Kritiker später sagte - durchaus entsprach. Im Verlauf der weiteren Planungsarbeiten kam ich auf den Gedanken, die Entwürfe einer Spezialfirma für Betonkonstruktion vorzulegen. Ich hielt mich um so mehr dazu verpflichtet, als ich dadurch eine wesentliche Einsparung bei den Fundamenten und dem inneren Gerüst erhoffte. Ich besprach diese Frage mit meinem Freund Théo van Rysselberghe, der von Belgien nach Paris übergesiedelt war. Sein Haus in Neuilly war das Zentrum unserer Maler- und Musikerfreunde aus der Zeit der ‘Vingt’ in Brüssel geworden. Théo wies mich auf den Bruder eines seiner Architektenfreunde hin, der sich auf Betonkonstruktionen spezialisiert hatte. Die beiden Brüder hatten eine Firma gegründet: Frères Auguste et Gustave Perret. Théo | |
[pagina 334]
| |
stellte den Kontakt mit Auguste Perret, dem Architekten, her, und ich suchte ihn mit den Theaterentwürfen auf. Ich wollte mich, erklärte ich ihm, ohne offiziellen Auftrag informieren, ob die Firma Perret die Ausführung in armiertem Beton zu übernehmen bereit sei. Fürs erste genüge mir eine unverbindliche Antwort, um mir über die Grundfrage klarzuwerden: Eisen oder Beton. Ich wollte dann das Problem dem Ingenieur Milon und dem Präsidenten Thomas unterbreiten. Nach einigen Tagen erhielt ich die Antwort, daß die Firma die Ausführung übernehmen wolle und daß mit einer bedeutenden Einsparung gerechnet werden könne. Im Besitz dieser Auskünfte bat ich den Präsidenten und Milon zu einer Besprechung mit Perret in meinem Atelier in der Rue Boccador. Milon gegenüber, dessen enthusiastisches Interesse, dessen peinliche Gewissenhaftigkeit und dessen freimütigen Charakter ich in den Monaten unserer Zusammenarbeit schätzen gelernt hatte, befand ich mich in einer besonders delikaten Situation. Aber der berühmte Fachmann für Eisenkonstruktionen war nicht im geringsten enttäuscht und mißbilligte mit keinem Wort die von mir eingeholten Informationen. Gabriel Thomas wiederum hatte allen Anlaß, sich über die mögliche Einsparung von mehr als hunderttausend Francs zu freuen. Das Ergebnis unsrer Besprechung kann mit wenigen Worten beschrieben werden. Die Firma Perret wurde mit der Ausführung des Rohbaus betraut. Milon und ich sollten uns im einzelnen mit Auguste Perret über die Konstruktion und die Stützen des Zuschauerraumes verständigen, an dessen Form, vor allem an der Disposition der Logen und Fauteuils des ersten, zweiten und dritten Balkons, nichts geändert werden sollte. Ich hatte keinerlei Anlaß zu Mißtrauen. Schließlich war ich es ja selbst, der die Firma Perret empfohlen und herangezogen hatte, ganz abgesehen davon, daß Théo van Rysselberghe sich wiederholt für die absolute Loyalität seines Freundes Auguste Perret verbürgt hatte. Aber die Ansprüche der Firma Perret und die Eingriffe Auguste Perrets wurden sehr bald unverschämt, die Art, wie er mit dem Präsidenten Thomas architektonische Fragen behandelte, zynisch. Ich erfuhr erst später, daß Gabriel Thomas mit Perrets Haltung einverstanden war und die Manöver billigte, mit denen er mich, einen Kollegen, zu verdrängen suchte. Ende März 1911 hatte das Komitee noch keine Entscheidung über die Ausgestaltung der Fassade getroffen. Ich legte im weiteren Verlauf verschiedene | |
[pagina 335]
| |
Skizzen vor, die nicht angenommen wurden. Mit der Zeit wurde ich mir klar darüber, daß hier ein System vorlag. Die Sache roch nach Intrige. Im Mai unterbreitete ich dem vollzählig versammelten Verwaltungsrat den neuen Entwurf einer steinernen Fassade, die entsprechend den Plänen von Ende März entwickelt war. Auf einem sehr genau ausgeführten Aquarell hatte Bourdelle die Reliefs eingezeichnet, die für den oberen Fries bestimmt waren. Seine Skizzen fanden keinen Beifall, und es entstand Schweigen. Zur letzten Sitzung, der ich beiwohnte, Juli 1911, hatte Gabriel Thomas, ohne mich vorher zu verständigen, Auguste Perret eingeladen. Ich war der Diskussionen in einer offenkundig feindseligen Atmosphäre müde geworden. Nach einiger Zeit packte ich meine Sachen zusammen, entschlossen, die Konsequenzen zu ziehen. In diesem Augenblick legte Auguste Perret zu meiner Überraschung die Skizze der heutigen Fassade auf den Tisch, eine sehr genau ausgeführte, wirkungsvolle Zeichnung. Dieses unqualifizierbare Verhalten, das offenbar mit dem Präsidenten und einigen Mitgliedern des Verwaltungsrates als Komplicen abgesprochen war, machte mich rasend. Am Tag nach dieser ‘denkwürdigen’ Sitzung verlangte ich von Gabriel Thomas die Lösung meines Vertrages. Ich wurde jeder Verpflichtung entbunden außer der des ‘Architecte Conseil’ (des beratenden Architekten). Gabriel Thomas appellierte an meine Geduld und wies auf die vertrauensvolle Atmosphäre hin, in der wir monatelang zusammengearbeitet hatten. Er bestätigte neuerdings, daß er keine wesentlichen architektonischen Änderungen zulassen werde, und versprach, Auguste Perret in seine Grenzen zu verweisen und einen modus vivendi zu finden, der Perrets Rolle als Konstrukteur und die meinige als Architekt präzisieren sollte. Aber meine Geduld war zu Ende. Ich mußte dringend nach Riga fahren und von dort nach Weimar. Bei meiner Rückkehr nach Paris war alles in voller Arbeit; der infernalische Lärm der Betonmaschinen vertrieb die Bewohner der angrenzenden Straßen. Guilleminault, der den Lauf der Ereignisse mit größerer Besorgnis verfolgte als ich, berichtete mir, daß er bei einem unserer Besuche auf der Baustelle die Betonarbeiter habe murmeln hören: ‘Das ist die deutsche Mannschaft!’ Der Ausspruch war vielleicht nicht aggressiv gemeint. Aber er stand mit dem überhitzten Nationalismus in Zusammenhang, der sich infolge der | |
[pagina 336]
| |
gefährlichen Aufschneidereien Kaiser Wilhelms II. - in seinen Reden und durch die Agadir-Affäre-bei jeder Gelegenheit bemerkbar machte. Auch der Bau des ‘Théâtre des Champs-Elysées’ war zur nationalen Sache geworden. Endlich gingen mir die Augen auf. Man zeigte mir einen Plan, datiert November 1911, mit dem Stempel der Firma Perret. Die Räume an den beiden Enden der Rundgalerien waren geopfert, die Linien der Balkone in einer Weise verändert, daß jede Spannung verschwunden und daß sie zu weichen, leeren Formgebilden geworden waren, die mühsam bis zum ersten Pfosten des Betonskelettes führten. Die Brüder Perret waren skrupellos vorgegangen. Sie scheuten sich nicht, meinen Entwurf frevlerisch zu verstümmeln, um dadurch die Platzzahl des Theaters - im Programm waren achtzehnhundert Sitze festgelegt - auf zweitausend zu erhöhen! Der Verwaltungsrat hatte Gabriel Thomas dazu gebracht, alles zu torpedieren, woran wir monatelang mit größtem Eifer gearbeitet hatten und was die Grundlage für jedes Theater, welchen Stils auch immer, bleibt: die gute Sicht für jeden Zuschauer. Es mag Monsieur Thomas nicht leichtgefallen sein, gerade auf diesen kapitalen Punkt zu verzichten. Er war ohne Zweifel überzeugt, daß ich einem solchen Eingriff niemals zugestimmt hätte, und schämte sich, mir diese Forderungen auch nur vorzuschlagen. In diesem Moment brach ich endgültig mit der ‘Société du Théâtre des Champs-Elysées’. Die Gesellschaft stimmte neuerdings der Auflösung meines Vertrages nur unter der Bedingung zu, daß ich unter Beibehaltung des Titels als beratender Architekt bereit wäre, Ratschläge zu erteilen und Gutachten abzufassen. Ich dagegen wollte mit dem ‘Théâtre des Champs-Elysées’ nichts mehr zu tun haben. Den weiteren Bauverlauf mit all seinen schmählichen Attentaten gegen meine Entwürfe, denen ich ohnmächtig zusah, konnte ich von den Fenstern meine Pariser Ateliers aus, das ich beibehalten hatte, verfolgen. Gordon Craig, der mich einmal auf der Durchreise in der Rue Boccador besuchte und dem gegenüber ich meiner Enttäuschung Ausdruck verlieh, drängte mich, mit ihm den Bauplatz zu besuchen. Auf dem ersten Balkon stehend, sagte er: ‘Was für einen Diskussionsstoff werden in fernen Jahrhunderten die Ruinen dieses Theaters den Kunsthistorikern liefern, die die Vergewaltigung aufzudecken versuchen, der dieser Bau ausgesetzt war.’ Im April 1913 wurde das Theater eröffnet. In den französischen und ausländischen Zeitungen erschienen prahlerische, begeisterte Artikel, die das | |
[pagina 337]
| |
übliche Maß überschritten. In der ‘Gazette des Beaux Arts’ veröffentlichte Paul Jamot, ein Kritiker, der in akademischen Kreisen, bei arrivierten Künstlern und mondänen Snobs großes Ansehen genoß, zwei ausführliche Aufsätze. Mein Interesse an allem, was um das Theater geschah, war erloschen, seitdem sämtliche Beziehungen zwischen mir, Gabriel Thomas und der Gesellschaft abgebrochen waren. Trotzdem hatten die Umtriebe, auf die Paul Jamot auf schamlose Weise anspielte, für mich eine gewisse Bedeutung. Die Animosität, die man in Frankreich gegen Deutschland und demzufolge gegen einen belgischen Künstler empfand, der zum Haupt einer deutschen künstlerischen Richtung geworden war und am Hof von Sachsen-Weimar eine bedeutende Stellung einnahm, mußte für den Kampf ausgenützt werden, den Jamot gegen mich und für Perret führte. Das Nationalgefühl wurde mobilisiert und die Priorität des ‘französischen Genies’ betont. Monsieur Jamot hat seine Aufgabe ernst genommen und mit einer gewissen Gründlichkeit durchgeführt. Ohne jede Hemmungen kam er zu dem Schluß, daß Auguste Perret der alleinige Erbauer des ‘Théâtre des Champs-Elysées’ sei und daß Gabriel Thomas die Ehre zukomme, dessen Grundideen entwickelt zu haben. Das klang kurz und bündig und schmeichelte dem Nationalstolz. Über die Bemerkung Jamots, Perret habe die ‘solide Grundlage des französischen Geistes, die Einfachheit, die Vernunft und die Klarheit’ nicht vergessen, mußte ich lachen, wenn ich dabei an die Loire-Schlösser oder an Garniers ‘Große Oper’ in Paris dachte. Auf jeden Fall war nach Jamots Meinung der Bau dadurch vor jeder Besudelung oder Verfälschung bewahrt worden, daß der Architekt es vermieden hatte, ‘die Nachahmung der Vergangenheit durch die Einfuhr ausländischer Moden zu ersetzen’. Der Name des Architekten Roger Bouvard verschwand noch vor dem meinen in der Versenkung. Ich selbst wurde in drei achtungsvollen Zeilen erledigt, in denen es hieß, ich habe ‘aus Deutschland meine persönliche Bildung und meine in einem Land gesammelten Erfahrungen mitgebracht, in dem bei zahlreichen neuerdings errichteten Theaterbauten die Konstruktionstypen und technischen Methoden den modernen Erfordernissen angepaßt werden konnten.’ Die übrigen Ausführungen Jamots mündeten in Huldigungen für Gabriel Thomas und den von ihm durchgesetzten Auguste Perret, den ‘vorzüglichen Schüler der Ecole des Beaux Arts’, die, wie jeder wußte, eine ‘Quelle künstlerischer Ideen’ war. | |
[pagina 338]
| |
In einem Aufsatz, der zuerst in der Zeitschrift ‘L'Art flamand et hollandais’ und später als Broschüre im Verlag der Librairie G. van Oest, Bruxelles-Paris, erschien, trat Jacques Mesnil den Ausführungen Jamots entgegen. Er war auf den Streit um das ‘Théâtre des Champs-Elysées’ durch einen Artikel in der von Pascal Forthuny herausgegebenen, fortschrittlichen Halbmonatszeitschrift ‘Les Cahiers de l'Art Moderne’ aufmerksam geworden, der mich als den eigentlichen Architekten des Theaters bezeichnete. Auf Perrets Einspruch hin zog Pascal Forthuny allerdings vierzehn Tage später seine Meinung zurück und schwenkte ins Lager meiner Gegner um. Jacques Mesnil, ein Schüler Elisée Reclus' in Brüssel und Hörer meiner Vorträge an der Brüsseler ‘Université Nouvelle’ in den neunziger Jahren, drang in das Dickicht der widersprechenden Daten und verschieden interpretierten Aussagen und Verträge ein. Mein Mitarbeiter Marcel Guilleminault, der mir von dem Tag an, da ich die ersten Striche des ersten Vorentwurfes gezeichnet hatte, geholfen und an den Besprechungen mit Gabriel Thomas teilgenommen hatte, gab Jacques Mesnil alle notwendigen Einblicke und orientierte ihn über sämtliche Einzelheiten des Arbeitsverlaufes. Mesnil unterzog alle Teile des Theaters einer strengen, unnachsichtigen Kritik und schloß auf Grund der von ihm bemerkten Fehler auf Widersprüche zwischen der Konzeption und der Ausführung. Die Freundschaft, durch die er mit mir verbunden war, hinderte ihn nicht, bestimmte Axiome meiner ästhetischen Überzeugungen und vor allem die Unausgeglichenheit zu kritisieren, mit der ich bisweilen das Element der Linie mißbraucht hatte - ‘völlig dem unkontrollierten van de Veldeschen Impuls hingegeben’, wie Jacques Mesnil sich ausdrückte. Auch seine auf hohem Niveau stehende Schlußfolgerung, eine Lehre für die Historiker, lautete kritisch: ‘Von Anfang an bestand bei diesem Bauvorhaben eine Zweideutigkeit, die sich unmittelbar in das dem Architekten gegebene Programm übertragen hat. Henry van de Velde hat sich diesem durch einen Grundirrtum befleckten Programm untergeordnet und so geschickt wie nur möglich einen Kompromiß zwischen der alten und neuen Vorstellung eines Theaters hergestellt. Aber trotz allen Scharfsinns, mit dem er die Gegensätze aufzulösen suchte, bleibt das Gleichgewicht der gegensätzlichen Prinzipien unstabil und das Werk gleichsam doppelsinnig. Die Einfachheit im Dekorativen entspricht nicht seinem mondänen Charakter; Form und Anordnung des Zuschauerraums erfüllen nicht alle | |
[pagina 339]
| |
Ansprüche eines Theaters, das ausschließlich der Kunst gewidmet ist. Das Ganze ist der Ausdruck eines geschmeidigen Talentes, das sich den Umständen anzupassen und alte Motive durch neue Mittel zu verjüngen versteht. Aber es ist kein Beispiel für die Zukunft, die neue Lösungen verlangt. Doch van de Velde weiß das besser als sonst irgend jemand.’ In der offiziellen Broschüre, die zur Eröffnung des Theaters erschien, hieß es bei der Beschreibung des Gebäudes: ‘Vereinigung von französischem Geschmack und angelsächsischer Technik’ sei das Ziel Gabriel Thomas' als Gründer des Hauses und Gabriel Astrucs als seines Direktors gewesen, und diese Formel habe auch den Mitarbeitern als Leitstern gedient. Unten auf derselben Seite stand in winzig kleinen Lettern: ‘Die Mitarbeiter sind die Herren A. und G. Perret, Konstrukteure und Dekorateure, Roger Bouvard, geschäftsführender Architekt, Henry van de Velde, beratender Architekt.’ Die Notiz erschien mehr als ein Jahr lang in den reichillustrierten Wochenprogrammen des ‘Théâtre des Champs-Elysées’. Ich hätte wohl gegen diese Publikation protestieren können, aber ich war dazu zu stolz. Es blieb mir nur eine Möglichkeit, gegen die Piraterie Auguste Perrets vorzugehen: das Urteil eines internationalen Schiedsgerichts. Meine Pariser Freunde, die meine Arbeit verfolgt hatten - Paul Signac, Maximilien Luce, Emile Verhaeren, Gordon Craig, Théo van Rysselberghe, André Gide -, drängten mich zu handeln. Harry Kessler hatte den französischen Kunstkritiker Arsène Alexandre über meine Absicht unterrichtet, und Alexandre erklärte sich bereit, das Präsidium des Schiedsgerichts zu übernehmen. Auch Kessler drängte mich, vor allem, weil Auguste Perret eine wichtige deutsche Kunstzeitschrift für sich gewonnen hatte. Ich dachte, den angesehenen Architekten der älteren Generation, ‘Père’ Bonnier, dessen aufrechte Haltung ich bei der Ausstellung ‘Art Nouveau’ bei Bing im Jahre 1896 kennengelernt hatte, zu gewinnen. Außerdem den Meister der holländischen Architekten, Petrus Hendrik Berlage, und einen englischen Kollegen. Ich weiß nicht, ob die Bande Perret-Thomas von meinem Plan zur endgültigen Lösung des Streitfalls Kenntnis erhielt. Sie hätte vor einem Gremium von Fachleuten ihre Ansprüche rechtfertigen müssen, während sie bisher den stichhaltigen Argumenten Jacques Mesnils nur die Aussagen von Kunstkritikern gegenüberzustellen in der Lage war, die nicht ernst genommen werden konnten. Falls sie sich weigerte, sich dem Schiedsgericht zu stellen, | |
[pagina 340]
| |
war der Fall erledigt. Ich selbst konnte in aller Ruhe der Entscheidung des Schiedsgerichtes entgegensehen, das sich mit einer einzigen Frage zu beschäftigen gehabt hätte: War die Grundkonzeption des Theaters, seiner baulichen Elemente und ihrer logischen Zusammenfügung in dem Vorentwurf definitiv festgelegt, den ich im Januar 1911 vorgelegt und in den Plänen von Ende März ausgearbeitet hatte, die auf dem Metallskelett von Milon beruhten, oder war sie es nicht? Ein Ereignis von entscheidender Bedeutung kam meinen Gegnern zu Hilfe: der Erste Weltkrieg, der ihnen während vier Jahren und noch lange Zeit danach die Möglichkeit bot, den Haß gegen alle auszuspielen, die in irgendeiner Verbindung zu dem Deutschland vor 1914 standen. Unter diesen war niemand mehr exponiert als ich, niemand eine geeignetere Zielscheibe für die Nationalisten, die nirgends stärker als in Frankreich und Belgien den Haß bis zur Weißglut geschürt hatten. Und wer erinnerte sich nach dem Krieg von 1914 bis 1918 noch an die offizielle Broschüre und an die Programme der Gesellschaft des ‘Théâtre des Champs-Elysées’, wer noch an den Konflikt Perret - van de Velde? | |
Zusammentreffen mit Gabriele d'AnnunzioZu Beginn unsres Jahrhunderts war die einzigartige gesellschaftliche und kulturelle Stellung von Paris noch unbestritten. Was sich in London oder Berlin auf künstlerischem oder geistigem Gebiet ereignete, blieb so gut wie unbekannt; keinerlei Resonanz war zu verspüren. Die wenigen Künstler und Intellektuellen, die der Pariser Gesellschaft die Bezeichnung ‘Elite’ verweigerten, wurden als gefährliche, umstürzlerische Elemente angesehen. Für sie - und ich gehörte zu ihnen, seitdem mich meine Arbeit für das ‘Théâtre des Champs-Elysées’ mit der ‘Gesellschaft’ in Berührung gebracht hatte - war es in der Tat eine ‘Gesellschaft’ im verächtlichsten Sinne des Wortes: Ersatz für eine wirkliche Aristokratie, nur auf das Äußere bedacht, sich selbst beweihräuchernd, in ewigem Karneval lebend, ständig auf der Jagd nach neuen Übergenüssen künstlerischer, geistiger, sexueller, dramatischer Art; nie befriedigt, überzeugt, den besten Geschmack zu besitzen, eine Welt der Intrigen, in der jeder den anderen beleidigte und prostituierte. | |
[pagina 341]
| |
Victor und Natascha Golubeff, über die ich meinen Lesern schon berichtet habe, gehörten zu den Außenseitern dieser ‘Gesellschaft’. Während der Jahre 1911 bis 1914 wohnte ich vielen Empfängen bei, die sie in ihrer seinerzeit von mir eingerichteten Wohnung an der Avenue du Bois de Boulogne gaben und bei denen sich immer interessante Menschen trafen. Eine der markantesten Persönlichkeiten der Pariser Saison von 1911 und 1912 war der italienische Dichter Gabriele d'Annunzio. Er hatte vor kurzem nach dem sensationellen Bruch mit Eleonora Duse Italien verlassen und seine berühmte Florentiner Villa ‘La Capporicia’ verkauft. In kürzester Frist war d'Annunzio der große Magnet der Saison geworden, und ebenso rasch setzte er seine Karriere als ‘Don Juan’ fort. Er konnte sich rühmen, hierfür außergewöhnliche Anlagen zu besitzen und beneidenswerte Erfolge errungen zu haben. Schon bei meiner ersten Begegnung mit d'Annunzio in der Wohnung meiner Freunde Golubeff fühlte ich mich von ihm physisch abgestoßen, ein Gefühl, von dem ich mich auch später nicht frei machen konnte. Ich habe während meines ganzen Lebens einen Widerwillen gegen Impotenz jeder Art empfunden, aber diesmal wurde mein Widerwillen durch die Begegnung mit einem Mann hervorgerufen, der sich im Zustand ständiger erotischer Hochspannung befand. Ich wäre vielleicht etwas toleranter gewesen, wenn ich d'Annunzios Werke mehr geschätzt hätte. Aber ich konnte weder an ihrer zweideutigen Stimmung noch an ihrem übertriebenen Wortschwall Gefallen finden. Eine Szene, der ich beiwohnte, kann ich nicht vergessen. Natascha Golubeff hatte in ergreifender Weise einige Lieder von Hugo Wolf gesungen, der damals besonders gefeiert wurde. Sie verließ den Musikraum. D'Annunzio blieb stehen, und eine Gruppe junger affektierter Frauen drängte sich um ihn. Seine Gegenwart und die oberflächlichen Redensarten, die er von sich gab, machten die Damen verrückt. Plötzlich sah ich, wie der kahlköpfige Faun bei seinem eigenen Spiel Feuer fing. Er warf flammende Blicke auf die kühnen Dekolletés. Hätten die Beteiligten sich nicht dem allgemeinen Aufbruch anschließen müssen, so hätte das Schauspiel, dessen Zeuge ich war, unfehlbar mit einem Skandal geendet. Ich machte mir keine Illusionen über den Fortgang der Ereignisse. Auch Natascha, deren ungewöhnliche Schönheit d'Annunzio reizen mußte, konnte | |
[pagina 342]
| |
dem neuen Super-Don-Juan nicht widerstehen. Sie verliebte sich sterblich in den italienischen Dichter. Victor Golubeff tat alles, um die Zerstörung ihres gemeinsamen Glücks zu verhüten und Natascha vor einem Abenteuer zu bewahren, dessen Ende bei der Skrupellosigkeit d'Annunzios nur zu deutlich vorauszusehen war. Er versuchte, seine Frau zu bestimmen, Paris zu verlassen. Er bat mich, in Fontainebleau Land für den Bau eines großen Hauses zu suchen. Seine augenblickliche Beschäftigung - die Herausgabe einer luxuriös ausgestatteten Zeitschrift ‘Ars Asiatica’, an der die bedeutendsten Kunsthistoriker und Orientalisten mitarbeiteten - erlaubte ihm nicht, sich zu weit von Paris zu entfernen. Mit Hilfe Marcel Guilleminaults, der in meinem Pariser Atelier verblieben war, wurde das Terrain bald gefunden. Guilleminault machte sich mit der gleichen Gewissenhaftigkeit an die Ausarbeitung der von mir skizzierten Entwürfe für das geplante Haus, mit der er mit mir beim ‘Théâtre des Champs-Elysées’ zusammengearbeitet hatte. Nachdem aber Victor und Natascha Golubeff sich zur Scheidung entschlossen hatten - Natascha war inzwischen d'Annunzios offizielle Mätresse geworden -, verzichtete Victor auf den Bau des Hauses. Er bat mich aber, für die Einrichtung des kleinen Hauses zu sorgen, das Natascha mit ihren beiden Söhnen, die sie bei sich behalten wollte, in der Avenue de la Faisanderie bezog. Aus den Möbeln und Gegenständen, die ich einst für die Wohnung in der Avenue du Bois de Boulogne geschaffen hatte, wählte ich aus, was zu gebrauchen war, und ergänzte es durch neue Entwürfe. Dabei kam ich viel mit Natascha zusammen, die nun nicht mehr, wie sie die früheren Heidelberger und Pariser Freunde nannten, ‘Tata’, sondern nur noch ‘Donatella’ heißen wollte, wie sie ihr berühmter Freund getauft hatte. Obwohl ich d'Annunzio in jener Zeit häufig begegnete, kamen wir uns nicht näher. Wir trafen uns bei Déjeuners im Haus in der Avenue de la Faisanderie und bei gemeinsamen Theaterbesuchen mit Donatella, wenn d'Annunzio einer Aufführung beiwohnte, die er versprochen hatte sich anzusehen. Auch bei Windhundrennen, zu denen ich Donatella gern begleitete, sah ich ihn. Die beiden unterhielten einen Hundezwinger mit ausgesucht schönen, wegen ihres Stammbaumes berühmten Tieren. (Es ist mir passiert, daß ich mich eines Abends auf der Leinwand eines Lichtspieltheaters erblickte, wie ich gemeinsam mit Donatella und d'Annunzio an der Barriere des Rennplatzes den Wettlauf der Hunde verfolgte.) | |
[pagina 343]
| |
Trotz meiner unabänderlichen Antipathie gegen d'Annunzio besuchte ich einmal mit ihm das Pariser Kupferstichkabinett, wozu er auch Graf Kessler eingeladen hatte. Hier erwies sich d'Annunzio als ausgezeichneter Kenner der italienischen Künstler, von denen ihn vor allem diejenigen interessierten, die den Tod des heiligen Sebastian dargestellt hatten. Sein Urteil über Besonderheiten und die künstlerische Qualität der einzelnen Zeichnungen war ausgezeichnet und zuweilen von überraschender Tiefe, seine Kommentare einfach, unpathetisch und frei von dem unerträglichen Schwulst seiner Verse, die wie Seifenblasen zerplatzten. Seitdem d'Annunzio - in französischer Sprache - am ‘Martyrium des heiligen Sebastian’ arbeitete, dessen Komposition er Claude Debussy übertragen hatte, umgab er sich mit unzähligen Abbildungen der Legende. Jedem, der es hören wollte, erzählte er, daß er in den ‘vollkommenen Formen der Beine der Rubinstein die Reinkarnation des jungen Heiligen’, des Schutzheiligen der Schützen, erkannt hatte. Ida Rubinstein war von Diaghilew für die Rolle der Sultanin im Ballett ‘Scheherezade’ verpflichtet worden, das ganz Paris und die Fremden ins ‘Théâtre des Champs-Elysées’ zog. Tonio Antoncini, d'Annunzios Sekretär, beschreibt in der Monographie über seinen Herrn und Meister, wie der Dichter nach einem Besuch des Balletts unter der Tür des Hotels Meurisse, wo sie wohnten, plötzlich ausrief: ‘Schau, das sind die Beine des heiligen Sebastian, nach denen ich schon so lange suche.’ Wahrlich, man nimmt seine Einfälle, wo man sie findet! An die Generalprobe des ‘Martyrium des heiligen Sebastian’ habe ich keine erfreuliche Erinnerung. Donatella hatte mich gebeten, den Abend mit ihr allein in der Proszeniumsloge des ersten Balkons zu verbringen. Das Theater war von einem höchst erwartungsvollen Publikum bis zum letzten Platz besetzt. Bevor der Vorhang sich hob, zog Donatellas Erscheinen alle Blicke auf sich. Nur wenige erkannten mich, der sich sofort in den Hintergrund der Loge zurückzog, als ihren Begleiter. Astruc übertraf sich selbst; noch nie hatte der routinierte Theatermann, der er war, eine solche Meisterschaft in der Inszenierung eines Bühnenwerkes gezeigt. Die Episoden des musikalischen Schauspiels, das einem alten Mysterium verwandt ist, hatten aber in ihrer Abfolge etwas Schleppendes und Verschwommenes. Die Voraussage des Kritikers de Montesquiou, der bei den Snobs als | |
[pagina 344]
| |
Orakel galt, bewahrheitete sich: ‘Man weiß wirklich nicht, was der dritte und vierte Akt noch bringen soll; den ersten beiden ist nichts mehr hinzuzufügen.’ ‘Tata’ beobachtete nervös die Bestürzung der glühendsten Bewunderer des italienischen Dichters und der geduldigsten unter den geladenen Gästen. Es war fast Mitternacht, als der Vorhang vor dem dritten Akt aufgehen sollte. Die Besucher des Parterres unterhielten sich in erheblicher Lautstärke, und man hörte sogar, wie mit den Füßen gescharrt wurde. Trotzdem kam niemand auf den Gedanken, gegen den Dichter und seine geschwollenen Tiraden zu protestieren, aber die Worte ‘zu lang’ und ‘streichen’ lagen auf aller Lippen. In diesem Moment bat mich ‘Tata’ dringend, de Montesquiou zu ersuchen, einzugreifen und alles zu tun, um eine Katastrophe zu vermeiden. Ich eilte zu dem bewunderten Dichter der ‘Hortensias bleues’, stellte mich vor und übermittelte ihm Donatellas Bitte. Was ich sagte, weiß ich nicht mehr, auch nicht, was der in Verlegenheit gebrachte Graf erwiderte; aber ich glaube mich zu erinnern, daß er mich am liebsten zu allen Teufeln gejagt hätte. Ich wurde jetzt selbst von größter Aufregung ergriffen und stürzte zur Bühne, wo ich sicher war, Astruc zu treffen. Ich fand ihn nervös, zusammen mit d'Annunzio. Ich übermittelte den beiden den Wunsch Donatellas, fluchte über die Gleichgültigkeit de Montesquious und empfahl ihnen dringend, das einzige Mittel anzuwenden, um die vorzeitige Flucht der Zuschauer zu verhindern: entschlossene und große Striche für die restlichen zwei Akte. | |
Vor Beginn des Ersten WeltkriegesIn Weimar war es ruhiger geworden. Ich erinnere mich, daß Ferdinand Hodler zu mir kam, als er Motive für das große Wandgemälde in der Universität Jena sammelte, das kurz vor dem Ersten Weltkrieg entstand. Georg Brandes besuchte uns im Haus ‘Hohe Pappeln’, und Jean Jaurès, von Emile Vandervelde begleitet, besichtigte einen ganzen Vormittag lang die Kunstgewerbeschule und das Seminar. Er machte uns die große Freude, bei uns | |
[pagina 345]
| |
zu Mittag zu essen. Bei dieser Mahlzeit - er redete fast allein, wir schwiegen - sprach er vor allem über Goethe und Nietzsche. In einem kurzen politischen Gesprächsintermezzo prophezeite er, er werde bald Minister werden. Als er die großen Sonnenblumen vor unseren Fenstern sah, schweifte er plötzlich ab und improvisierte einen wundervollen Hymnus an die Natur, an die Herrlichkeit des Lebens und an den kommenden Triumph der Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Immer mehr fühlte ich mich in der Atmosphäre tödlicher Mittelmäßigkeit isoliert; abgestoßen von der Teilnahmslosigkeit und dem Dünkel neuer Hofleute, die den früheren - gestorbenen oder in Ungnade entlassenen - folgten, welche den Künstlern wenigstens noch einen gewissen Respekt entgegengebracht hatten. Trotzdem muß ich gestehen, daß ich dieser Isolierung, meiner Nicht-Teilnahme am Leben in Weimar in gewisser Beziehung meine Reife, um nicht zu sagen meine Meisterschaft verdanke. Sie hat sich nicht auf normale Weise in einem günstigen Klima oder unter den Strahlen einer wärmenden Sonne vollendet. Das Glück hat mir selten gelächelt, und keine Enttäuschungen und Widerwärtigkeiten sind mir erspart geblieben. Trotzdem hat mein steigender Ruf die Wolken, die sich über mir zusammenballten, vertreiben und mir immer dann einen Sonnenstrahl gegönnt, wenn mein Schaffen und meine bescheidene Mission besonders bedroht waren. Aber ich habe mir nie große Illusionen gemacht. Der Ernst der Entscheidung, vielleicht meine Stellung in Weimar und Deutschland aufgeben zu müssen, kam mir nur langsam zum Bewußtsein. Einerseits sah ich nur zu deutlich die Risse, die das Gebäude meines Schaffens zu zerstören drohten, das ich so sorgfältig errichtet hatte, andrerseits hatte ich nie mehr zu tun als gerade in diesen Jahren, die von mir eine übermäßige Konzentration der schöpferischen Kräfte verlangten. Ich arbeitete täglich bis tief in die Nacht hinein. Ich versteckte mich buchstäblich, was um so leichter möglich war, als ich mir, um ungestört zu bleiben, in unserem Garten ein Atelier mit einem Schlafzimmer hatte bauen lassen. So blieb ich unkontrolliert, und niemand erfuhr, wieviel Stunden der Nacht ich meinen privaten Arbeiten widmete. Neben meinen Aufgaben in Riga und Paris waren eine Reihe von Villen in Weimar, Gera, Hannover und Chemnitz im Bau. Von den Erfurter Stadtbehörden erhielt ich den Auftrag, Pläne und ein Modell für ein Museum auszuarbeiten. Edwin Redslob, der schon | |
[pagina 346]
| |
mit sechzehn Jahren meine Vorlesungen in Weimar besucht hatte, war nach kurzer Vorbereitungszeit in Berlin zum Direktor der Kunstsammlungen Erfurts ernannt worden und hatte als erste seiner Maßnahmen diesen Auftrag an mich erwirkt. Das Übermaß an Arbeit, die ständige Sorge um die in Ausführung begriffenen Bauten, die vielen notwendigen Reisen zu ihrer Überwachung ließen mich befürchten, mit der Zeit auf meine Lehrtätigkeit und auf die Führung der Werkstätten verzichten zu müssen, in denen meine eigenen Schöpfungen hergestellt wurden: die Stoffe und Teppiche für die Innenausstattung meiner Häuser, Möbel, Beleuchtungskörper, Keramik, Schmuck, Goldschmiedearbeiten und Bucheinbände für meine vielen Auftraggeber. Was sollte ich tun, wenn ich alles aufgeben müßte, was für meine berufliche Tätigkeit und meine Mission ebenso unentbehrlich war wie das Orchester für einen Dirigenten? Mich beschäftigte der Gedanke, an eine andere Schule industrieller Kunst berufen zu werden. Außerdem blieb mir die Möglichkeit, private Werkstätten zu gründen und mich mit einer Anzahl ausgewählter Schüler zu umgeben, ein Plan, den ich mit besonderer Vorliebe überdachte. Mein Grundstück in Ehringsdorf war groß genug zur Errichtung solcher Werkstätten. Ich machte sogar schon Skizzen für ein Projekt, das unser Wohnhaus, mein kleines Gartenatelier und neue Bauten zusammenfaßte. Es wäre eine kleine Fabrik inmitten von Blumen, eine Arbeitskolonie in einem Garten geworden. Und ich nahm mir vor, das Ganze mit einer Mauer zu umgeben, um vor allen ungebetenen Blicken und vor jeder Berührung mit einer Welt geschützt zu sein, von der mich abzusondern ich allen Grund hatte. Das anstrengende Leben, das ich seit Jahren führte, machte einen Erholungsaufenthalt notwendig. Als ich 1912 in dem von Dr. Ludwig Binswanger geleiteten Sanatorium Bellevue in Kreuzlingen eintraf, sagte der Arzt: ‘Sie sind bald fünfzig Jahre alt, es ist Zeit, hohe Zeit für einen Menschen, der sich wie Sie verausgabt hat, auszuspannen.’ Das auf Schweizer Seite am Ufer des Bodensees gelegene Sanatorium hatte unter Binswangers Leitung - er war der Bruder des berühmten Psychiaters der Jenaer Universität, in dessen Klinik ich vor meiner Abreise nach Kreuzlingen einige Tage verbracht hatte - Weltruf erlangt. Die Pa- | |
[pagina 347]
| |
tienten kamen aus der deutschen Industrie- und Finanzwelt, aus der internationalen Diplomatie und aus der Aristokratie von ganz Europa; Neurastheniker verschiedenen Grades, teils in geschlossenen Häusern, teils in der offenen Villa Bellevue, wo sich Überarbeitete, Lebemänner, hysterische Damen und Alkoholiker der ausgezeichneten Kur unterzogen. Ich fühlte mich in diesem Milieu zunächst fehl am Ort. Dank der besonderen Sorge Binswangers, der mich aller gesellschaftlichen Verpflichtungen enthob, paßte ich mich aber rasch an. Die Schmerzen im Nacken verschwanden bald. Vor wieviel Jahren hatte ich die nämlichen Schmerzen, diesen unheimlichen Griff eines Ungeheuers verspürt? Es war in Calmpthout gewesen während der zwei Jahre der Neurasthenie, in denen sich die Metamorphose vollzog, die aus dem Maler, dem egoistischen Naturschwärmer den glühenden Apostel, den Prediger des Glaubens gemacht hatte, der das Heil und die Erlösung von der Häßlichkeit in der Rückkehr zum Grundprinzip der vernunftgemäßen Gestaltung erblickte und in der Anerkennung der Moral als elementarer Voraussetzung der Schönheit.
Mein fünfzigster Geburtstag sollte und konnte nicht offiziell gefeiert werden, nachdem alle meine Verbindungen zum Großherzog und zum Hofe abgebrochen waren. Ich hatte Minister Rothe wissen lassen, daß ich an keiner Kundgebung teilnehmen, keine Auszeichnung annehmen würde und daß ich beabsichtigte, den Tag mit meiner Familie und einigen intimen Freunden zu verbringen. Damit tat ich übrigens Seiner Exzellenz einen Gefallen, weil sie der unangenehmen Aufgabe enthoben war, den Großherzog auf den 3. April und die angemessenen Veranstaltungen aufmerksam machen zu müssen. Andrerseits dachte ich nicht daran, mich den Ehrungen von seiten der Schüler meines Instituts zu entziehen, wie ich auch das Geschenk einer Gruppe von Freunden annahm, die den Bildhauer Georg Kolbe, der bei den letzten Ausstellungen der Berliner Sezession zu höchster Anerkennung gelangt war, beauftragt hatten, meinen Kopf zu modellieren. Wenige Tage vor dem Fest erfuhr ich, daß Elisabeth Förster-Nietzsche zur Feier meines Geburtstages eine Reihe von Freunden, die mit meinem Schaffen und meinen Bestrebungen der letzten zwölf Jahre besonders verbunden waren, zu sich ins Nietzsche-Archiv einzuladen beabsichtigte. Die Glückwünsche mei- | |
[pagina 348]
| |
ner Schüler und Mitarbeiter wollte ich in meinem Privatatelier entgegennehmen. Welche Überraschung für mich, mein großes Atelier in ein Meer von herrlichen Blumen verwandelt zu sehen, in deren Mitte die Bronzebüste von Kolbe stand, umgeben von den Entwürfen und Modellen meiner jüngsten architektonischen Arbeiten: der Fassade des ‘Théâtre des Champs-Elysées’, des Museums für Erfurt, des Nietzsche-Stadions und der Villa Körner in Chemnitz. Die Begeisterung meiner Schüler kannte keine Grenzen. Die strahlenden Augen der jungen Mädchen und Männer waren beredsamer als ihre Worte, mit denen sie mir ein von der Buchbinderwerkstatt angefertigtes Lederbehältnis übergaben, das Zeichnungen, Aquarelle und andere Beweise ihrer Verehrung enthielt. Daß sich der Sprecher der Freunde, Ernst Hardt, ungezwungener und besser ausdrückte, verstand sich von selbst. Er sprach bewegt von dem Erlebnis, sich mit uns in einer Atmosphäre der Schönheit und des Glaubens an die Zukunft zu fühlen. Ernst Hardt fand genauso großen Beifall wie ich selbst, nachdem ich in einer improvisierten Dankansprache versucht hatte, einige Aspekte der Schönheit zu umschreiben: wie sie sich in den vollendeten Werken der Schöpfung äußert, genährt aus der reinen Quelle vernunftgemäßer Konzeption, die Trägheit überwindet, die Körper durchdringt und die Glieder spielen läßt, den Menschen aus der Häßlichkeit ungeformter Masse heraushebt und ihn gehen, schwimmen und tanzen lehrt und selbst die Tiere in harmonische Bewegung setzt: ein Lebensstrom, der auch die Knospen zum Blühen bringt, die Kelche der Blumen öffnet, der in wunderbarer Weise die Linie schwingen und die Steine singen läßt. Meine jungen Schüler hatten sich oft über die Vorstellung gewundert, die ich mir von der vollendeten, empfindungsvoll belebten Schönheit machte, wenn ich ihre Arbeiten kritisierte und korrigierte und sie stets auf das gleiche Ziel hinwies: den eigenen Lebensstrom dem Gegenstand zuzuleiten, der geschaffen werden soll. Auf ein Zeichen meiner Frau öffneten sich die breiten Türen in den Saal, in dem sich das kalte Büfett befand, zu dem Maria und drei meiner Töchter die Anwesenden führten. Wir konnten das Ende des Festes aber nicht abwarten, weil wir uns zum Diner ins Nietzsche-Archiv begeben mußten. Neben meinen Freunden hatte Frau Förster-Nietzsche den Staatsminister Rothe, den Vertreter Weimars im Berliner Staatsrat und den Oberhofmarschall als persönliche Gäste geladen. Die Gastgeberin verlieh der Veranstal- | |
[pagina 349]
| |
tung einen feierlichen Ton, der nicht ohne Absicht gegen die Gleichgültigkeit des Großherzogs gerichtet war. Karl Scheffler hielt die für mich sehr ehrenvolle Gratulationsrede. Diese Ansprache erschien später in dem Band ‘Henry van de Velde. Vier Essays von Karl Scheffler’. Der erste Essay war anläßlich meiner ersten Berliner Ausstellung in der ‘Zukunft’, der zweite und dritte 1906 und 1911 in der Zeitschrift ‘Kunst und Künstler’ erschienen, die der unter Max Liebermanns Führung stehenden Berliner Sezession nahestand. Karl Scheffler wirkte als Chefredakteur der Zeitschrift. Im Vorwort des Bandes ‘Vier Essays’ stellte er fest, kein Wort seiner früheren Aufsätze verändern oder zurückziehen zu wollen, trotz der Wiederholungen und Widersprüche, die vorhanden seien. In seinen Ausführungen beschäftigte sich Scheffler mit der besonderen Stellung, die ich im Kunstleben einnahm: ‘Es handelt sich um Dinge, die unsere Nachkommen vielleicht nur wenig noch bewegen werden, die uns aber viel bedeuten. Es handelt sich um Auseinandersetzungen mit schöpferischen Übergangskräften’, oder an anderer Stelle: ‘Es kommt einem kaum zum Bewußtsein, wie merkwürdig van de Veldes Situation in unserer Mitte ist’ - eine Überlegung, die ihn dazu führte, in meinem Schaffen einen ‘Fall’ zu sehen. Scheffler hatte sich in diesem Zusammenhang seine eigenen Gedanken gemacht. Er wünschte, daß mir Gelegenheit zu Bauten gegeben würde, die weniger auf Nützlichkeit gerichtet seien als die bisher von mir verwirklichten Pläne. Die Worte seiner Geburtstagsansprache waren frei von jeder Dialektik, sie enthielten keine Vorbehalte, sie waren menschlich. Sie ließen erkennen, daß er mit dem gleichen leidenschaftlichen Interesse der Entwicklung meiner Schöpfungen folgte wie alle meine Freunde, unter denen er einer der ernstesten geblieben ist. | |
Ein Geplantes Nietzsche-DenkmalIn jenen Jahren beschäftigte sich Harry Kessler mit dem Plan, zur Erinnerung an Friedrich Nietzsche in Weimar ein Denkmal zu errichten. Zur Unterstützung seiner Idee gedachte er, die Elite der Philosophen, Intellektuellen, Künstler und Kunstfreunde aller Länder heranzuziehen; die finan- | |
[pagina 350]
| |
ziellen Mittel sollten durch eine internationale Subskription aufgebracht werden. Von Anbeginn an rechnete Kessler, dem zunächst eine Art Tempel vorschwebte, mit meiner Mitarbeit als Architekt und mit Aristide Maillol als Bildhauer für eine Plastik. Die ersten deutschen und ausländischen Freunde, an die sich Kessler wandte, waren mit seinen Ideen und mit seiner Wahl des Architekten und Bildhauers einverstanden. Und auch als er zum ersten Male mit Elisabeth Förster-Nietzsche über seine Absichten und die vorgesehene Art ihrer Verwirklichung sprach, schien es, daß keinerlei Meinungsverschiedenheiten das Einverständnis zwischen ihm und der Schwester Nietzsches bedrohen könnten. Kaum war bekanntgeworden, daß ich mit dem Entwurf des Monumentes beauftragt werden sollte, da begann es im Blätterwald zu rauschen, und der Vorhang hob sich wieder über dem alten Schlachtfeld der ‘Barbaren’ und ‘Philister’, die unerschütterlich die Positionen hielten, die sie seit der Dresdner Ausstellung von 1906 eingenommen hatten. Harry entwickelte seine Ideen weiter. In einem Brief vom 14. April 1911 schrieb er mir: ‘Ich erweitere den ersten Plan, ich mache ihn lebendiger und denke, dem Tempel - springen Sie nicht in die Höhe! - ein Stadion beizufügen.’ Zwei entgegengesetzte architektonische Gebilde: der Tempel als geheiligter Ort der Besinnung und inneren Sammlung, das Stadion der Ort eindrucksvoller Schauspiele der Gewandtheit, der athletischen Kraft. War Nietzsche nicht der erste moderne große Denker, der die Schönheit der Kraft und die Lebensfreude predigte? Hieß es nicht, seine Gedanken zu verwirklichen, wenn wir die kühnen Spiele der Jugend einbezogen, wie es eine Verwirklichung der christlichen Idee bedeutet, wenn eine Kirche mit einem Hospital vereinigt wird. Elisabeth Förster-Nietzsche hatte sich zunächst mit Kesslers Plan eines Stadions befreundet, allerdings ohne sich zu sehr dafür zu enthusiasmieren. Auf der Höhe der Pressefehde, die um das Projekt des Nietzsche-Stadions von Graf Kessler, van de Velde und Maillol entstanden war, erschien im Nietzsche-Archiv eine Delegation deutscher Künstler, die dem vom internationalen Ausschuß verfolgten Projekt feindlich gegenüberstand. Aus den Händen dieser Gegner empfing Elisabeth Förster-Nietzsche die Abschrift eines Briefes Friedrich Nietzsches, dessen Original die Delegation vorwies, | |
[pagina 351]
| |
in dem es heißt: ‘Die Nachäfferei des Griechentums durch dieses reiche, müßiggängerische Gesindel aus ganz Europa ist mir ein Greuel. Die Leute ahnen nicht, aus welchen tiefen religiösen und politischen Vorstellungen die griechischen Feste hervorgegangen sind. Ich flüchte vor diesem hohlen Lärm sensationsgieriger Darsteller und Zuschauer in die Einsamkeit und Stille.’ Diese bitteren Worte ihres Bruders erschütterten unsere hochverehrte Freundin. Sie unterrichtete Harry Kessler über den unvermuteten Besuch und über den Brief Nietzsches: ‘Ich möchte Sie’, schrieb sie, ‘lieber Freund, auf das innigste bitten, diese Pläne ad acta zu legen oder mindestens zehn Jahre zu warten. Ich kann jetzt nicht mehr anders, als mich dagegen zu erklären, und Sie können mich ja als Vorwand nehmen, wenn Sie die Sache auf später hinausschieben wollen. Sie wissen ja am besten, wie sehr ich von Anfang an dagegen war, aber ich dachte schließlich, daß ich eine alte Frau wäre und mit dem Empfinden der Gegenwart nicht mehr übereinstimmte. Glauben Sie mir, mein lieber Freund, wenn ich Sie und van de Velde jetzt von dem Plan zurückhalte, so erspare ich Ihnen und ihm nur einen Skandal, der auch dem Namen meines Bruders schaden würde.’ Jeder andere als Harry Kessler wäre durch den Rückzug des gegebenen Wortes, den Elisabeth Förster-Nietzsche in kategorischer Weise vollzog, aus der Fassung gebracht worden. Mir schien, daß er ihre Erklärung als eine vorübergehende Laune auffaßte, der er keine Bedeutung zumaß. Aber er unterschätzte ihre explosive Energie. Zwei Naturen, zwei Willen, die beide nicht bereit waren, sich zu beugen, hatten sich festgenagelt. Im Gegensatz zu Elisabeth Förster-Nietzsche und den anderen Gegnern hatte der von Kessler gebildete internationale Ausschuß gegen seine Dispositionen nichts einzuwenden. Er entschied in einer Sitzung am 9. Juni 1912, daß der Subskriptionsbetrag endgültig für den Bau des Monumentes, das nach meinen Entwürfen aus einem Tempel und dem Stadion bestehen sollte, verwendet werde. Ich wurde offiziell mit der Ausführung des Denkmalbaus betraut und das Ehrenpräsidium des Ausschusses dem deutschen Reichskanzler Fürst Bülow angetragen. Nur drei ausländische Namen figurierten auf der Subskriptionsliste, die auf dreihundert Personen beschränkt war. Ich forschte in den gedruckten Schriften Nietzsches und in seinen handschriftlichen Notizen, um mich mit seinen Vorstellungen und Gedanken | |
[pagina 352]
| |
über Architektur vertraut zu machen. In der ‘Götzendämmerung’ fand ich folgende Worte: ‘Architektur ist eine Art Macht-Beredsamkeit in Formen, bald überredend, selbst schmeichelnd, bald bloß befehlend. Das höchste Gefühl von Macht und Sicherheit kommt in dem zum Ausdruck, was großen Stil hat. Die Macht, die keinen Beweis mehr nötig hat; die es verschmäht, zu gefallen... ein Gesetz unter Gesetzen.’ Und an anderer Stelle des gleichen Buches: ‘Das ‘Schöne an sich’ ist bloß ein Wort, nicht einmal ein Begriff.’ Zur Frage der Entmaterialisierung des Stoffes fand ich in ‘Menschliches Allzumenschliches’ (I. 145) eine Aufzeichnung der Gefühle, die Nietzsche bei einem Besuch in Paestum empfunden hat: ‘Als ob eine Seele urplötzlich in einen Stein hineingezaubert sei und nun durch ihn reden wolle.’ Solche Worte bestätigten meine eigenen Empfindungen, die ich mühsam meinen Schülern in Weimar klarzumachen suchte. Hätte das Schicksal Nietzsche nicht allzufrüh niedergestreckt, so hätte er in den Menschen meiner Generation die Schüler gefunden, nach denen sich sein ungeduldiges Genie zeit seines Lebens gesehnt hat. Meine Freunde Fernand Brouez, Jacques Dwelshauvers, der Übersetzer des ‘Zarathustra’ in französische Sprache, die beiden klugen Essayisten Teodor Wyzewa und Felix Fénéon sowie Paul Signac - alle waren vom Geist Nietzsches geprägt. Trotz der unveränderten Gegnerschaft der Schwester Nietzsches trieb Kessler seine Pläne für das Stadion vorwärts. Er sammelte neue Anhänger: unter den französischen Gelehrten und Künstlern den Literaturprofessor Henri Lichtenberger, Jules Gauthier und André Gide, Anatole France und - vielleicht - Octave Mirbeau, Maurice Barrès und Charles Maurras, ‘wenn ihr Chauvinismus sie nicht abhält’, sagte Harry; in Italien Gabriele d'Annunzio; Gilbert Murray, H.G. Wells, Raleigh und andere in England. Elisabeth Förster-Nietzsche opponierte weiter. Der allgemeine Widerstand wurde immer größer und erstreckte sich schließlich auch auf die Bevölkerung Weimars, die Spitzen der Behörden, den Großherzog. Das Gerücht verdichtete sich, Graf Kessler habe Millionen erhalten. Ich sah bald, welche Rolle diese Millionen spielen sollten. Weder unsere verehrte Freundin noch der Großherzog blieben dem Goldregen gegenüber unempfänglich, der sich auf Weimar ergießen sollte! Eine neue Goldader - der Kult Friedrich Nietzsches - war in dem Augenblick entdeckt worden, als die Mediokrität der ‘Goethe-Priester’ den Goethe-Kult zu entwerten drohte. | |
[pagina 353]
| |
Bei diesem Stand der Dinge erhielt ich von Elisabeth Förster-Nietzsche einen ihrer Sekretärin diktierten Brief von zwölfhundert Wörtern, in dem sie mir erklärte, daß sie ihrerseits mit schwedischen Freunden Kontakt aufgenommen habe, die seit der Gründung des Nietzsche-Archivs zu den Kosten, welche sie anfänglich allein aufbringen mußte, beigetragen hatten, um jetzt endlich das Archiv finanziell auf einen festen Boden zu stellen. Dieser Brief war für mich die Erklärung für ihre Schwenkung: die Aussicht auf die Millionen! Frau Förster-Nietzsche bezog sich in diesem Brief auf die Gleichgültigkeit Harry Kesslers, die dieser bei einem kürzlichen Besuch zutage gelegt habe, bei dem sie ihm die schwierige Lage darstellte, in dem sich das Nietzsche-Archiv befand, und auf die Gefahr einer Schließung hinwies. Sie wundere sich und fühle sich durch Graf Kesslers Haltung um so mehr verletzt, als er dem Ausschuß der Leitung des Nietzsche-Archivs angehöre. Sie fuhr fort: ‘Einer Phantasterei jagt er nach, und es kommt ihm nicht in den Sinn, daß ich mich zwanzig Jahre mit Sorgen und Ängsten geplagt habe, und er mir wohl zur Erreichung meiner Wünsche etwas zu Hilfe kommen könnte!’ In gewisser Beziehung verstand ich den Ärger, den das ‘Wunder der Millionen’ bei Elisabeth Förster-Nietzsche auslöste. Andrerseits muß ich der Wahrheit zuliebe sagen, daß die Gleichgültigkeit, die sie bei Harry Kessler zu bemerken glaubte, ein dummes Mißverständnis gewesen ist. Nach einem Besuch im Nietzsche-Archiv zusammen mit Kessler bat ich unseren gemeinsamen Freund Eberhard von Bodenhausen, Frau Förster-Nietzsche mit Rat und Tat beizustehen und die Zukunft des Archivs von der Ausführung des bedrohten Monumentes zu trennen. Eberhard löste diese Aufgabe mit der ihm eigenen freundlichen Gewissenhaftigkeit, mit der er sich sein Leben lang der Lösung künstlerischer und kultureller Fragen gewidmet hatte. Ende des Jahres 1913 betrachtete ich das Projekt des Nietzsche-Monumentes als erledigt. Ich nahm diese Entwicklung der Dinge mit Resignation hin, wie ich mir auch keine Illusionen anläßlich eines unerwarteten Besuches des Großherzogs und der Großherzogin - der Großherzog war im Jahre 1910 eine zweite Ehe eingegangen - machte, zu denen ich seit den Tauffestlichkeiten des Erbprinzen keine Beziehungen mehr unterhalten hatte. Der Großherzog schien angesichts der hypothetischen Millionen kompromißbereit und vielleicht sogar geneigt, die Beziehungen zum Gra- | |
[pagina 354]
| |
fen Kessler wiederaufzunehmen. Mit einer albernen Frage ließ er mich in seine Karten sehen: ‘Ist es wohl unerläßlich, das Projekt des Grafen Kessler so offen mit dem Namen Friedrich Nietzsches zu verbinden, lieber Professor?’ Auf diese Frage gab es keine Antwort; mein Schweigen machte den Großherzog verdutzt und ärgerlich. | |
Werkbundtheater in Köln 1914Im Laufe des Winters 1913/14 übertrug mir die Leitung des Deutschen Werkbundes den Bau eines Theaters zu der für den Sommer 1914 in Köln geplanten Werkbundausstellung. Die Architekten für die verschiedenen anderen Bauten der Ausstellung, zu der die Kölner Stadtbehörden das Gelände zur Verfügung gestellt hatten, waren schon erheblich früher bestimmt worden. Nur der Auftrag für das Theater blieb lange in der Schwebe, obwohl es unter den Werkbundmitgliedern nicht an Kandidaten fehlte. Ich hielt es nicht für angebracht, irgendwelche Schritte zu unternehmen, geschweige denn mich direkt an die Ausstellungsleitung zu wenden. Es wurde offenbar lebhaft hin und her beraten, Intrigen wurden gesponnen, und schließlich erschien auch mein Name in den Diskussionen. Im Schoß des Werkbunds und der Ausstellungsleitung bildeten sich zwei Parteien, die entgegengesetzte Meinungen in der Frage vertraten, ob man einen ausländischen Architekten mit der Ausführung des Theaters betrauen könne. Die einen fanden, ich sei wegen meiner belgischen Staatsangehörigkeit nicht in der Lage, an einer vom Deutschen Werkbund unter Hinzuziehung verwandter Institutionen Österreichs und der Schweiz organisierten Ausstellung teilzunehmen. Andere - unter ihnen befanden sich Richard Riemerschmid, Hermann Obrist, August Endell, Bruno Taut, Otto Bartning, Karl Ernst Osthaus und Theodor Heuss, die sich besonders für mich einsetzten - erklärten, meine Teilnahme an der Gründung des Werkbundes, die Schöpfung meines Weimarer Seminars, eine der Grundlagen der Werkbundidee überhaupt, und meine Mitgliedschaft in der Werkbundleitung genügten vollauf, mich zur Teilnahme an der Kölner Ausstellung zu berechtigen. Wieder einmal das gleiche Hindernis: der Nationalismus. | |
[pagina 355]
| |
Ohne die Unterstützung des Kölner Oberbürgermeisters Dr. Konrad Adenauer, der dem Organisationskomitee präsidierte - des heutigen Kanzlers der Deutschen Bundesrepublik -, wäre ich nicht zum Bau des Werkbundtheaters gekommen, das zusammen mit dem von Walter Gropius auf der Kölner Ausstellung errichteten Fabrikgebäude einen Meilenstein in der Entwicklung der von belgischen, holländischen, französischen und deutschen Vorkämpfern geschaffenen ‘Neuen Architektur’ darstellt. Der Auftrag wurde mir im Februar 1914 erteilt, im Juni des gleichen Jahres sollte das Theater eröffnet werden. Es war ein wahres Husarenstück und seine Durchführung nur möglich, weil ich mich mit einer verblüffend einfachen Bühne begnügte. Der für das Theater bestimmte Platz in der unmittelbaren Nähe des Rheindeiches war wenig günstig. Ich hatte mich in Paris mit einem schlecht gewählten Terrain herumschlagen müssen, sollte ich in Köln in eine ähnliche Falle geraten? Der Wunsch, nach eigenem Ermessen, unter eigener Verantwortung ein Theater, ein Sommertheater bauen zu können, dessen Bühne dem Regisseur alle Möglichkeiten experimenteller Inszenierung mit einem Minimum technischer Einrichtungen bot, machte mir aber die Entscheidung leicht. Der Bau, der nun in raschem Tempo an der Stelle entstand, mit der ich mich abgefunden hatte, wurde aus dauerhaftem Material errichtet. Nur die Bedachung hätte im Hinblick auf eine längere Lebensdauer durch widerstandsfähigeren Schiefer oder Kupfer ersetzt werden müssen. Noch während der Bauzeit setzte ich mich mit verschiedenen Gruppen von Theaterfreunden in Verbindung, um Möglichkeiten zu finden, daß das Theater nach Beendigung der Ausstellung weitergeführt werden könnte. Wir dachten an alljährliche Darbietungen von neuen und unbekannten Werken ausländischer Dramatiker, bei denen zugleich die Inszenierungsexperimente hätten weiterentwickelt werden können, zu denen man während der Ausstellung von 1914 Gelegenheit hatte. Eine Kette von Unwettern während der Monate Mai und Juni mit sintflutartigen Wolkenbrüchen verzögerte die Eröffnung des Theaters, die nach Tagen fieberhafter Arbeit am 18. Juni 1914 stattfand. Als Eröffnungsvorstellung wurde Goethes ‘Faust’ gegeben, ein Werk, das mehr als jedes andere der deutschen dramatischen Literatur geeignet war, die Vorzüge der von mir angewendeten dreiteiligen Bühne für den ununterbrochenen Ab- | |
[pagina 356]
| |
lauf der Bildfolge ins Licht zu setzen. Barnowsky, der die Aufführung inszenierte, hatte für die Bühnenbilder einen mittelmäßigen Maler engagiert. Das Ensemble bestand aus vorzüglichen Schauspielern, unter denen sich Lina Lossen, Traute Carlsen, Friedrich Kayssler, Albert Steinrück und Curt Goetz befanden. Der Grundriß des Zuschauerraumes war ein Rechteck, die Sitze auf einem ansteigenden Parkett angeordnet, dessen hinterer Teil auf einer Estrade lag. Die seitlich liegenden Türen führten in foyerartige Gänge rechts und links des Saales. Seine Wände waren mit profilierten Holzplatten verkleidet, die baufertig von einer Fabrik geliefert wurden. Ein großes, amarantrotes Seidenvelum bedeckte den mittleren Teil des Plafonds. Durch die durchbrochenen Ornamente des Frieses zwischen den Pilastern flutete indirektes elektrisches Licht. Der Zuschauerraum machte einen tempelartigen Eindruck. Er hatte etwas vom Ernst herber, buddhistischer Architektur. Die Farbklänge beruhten auf einer von Amarantrot zu hellem Zinnober verlaufenden Skala. Die bewußt zurückhaltende dekorative Ausgestaltung erschien wie von dem Weihrauch und der Patina von Jahrhunderten gedämpft. Die Anlage der Bühne beruhte auf langjährigen Studien, auf Eindrücken, die ich als Zuschauer und als Besucher von Theatervorstellungen gehabt hatte, und auf den Erkenntnissen der in Gemeinschaft mit Ingenieur Milon gemachten Studienreise. Das erste Ergebnis meiner Überlegungen war die Überzeugung, daß alle noch so scharfsinnigen Erfindungen der Bühnentechniker zu kompliziert und zu schwerfällig waren. Weder die Drehbühne noch die auf Schienen laufenden, verschiebbaren Seitenbühnen riefen den Eindruck hervor, daß der Schauplatz, der Ort der Darstellung sich wirklich ändere. Trotz aller Verschiedenheit der Dekorationen spielten sich die Szenen stets an der gleichen Stelle ab. Der Verzicht auf den Bühnenrahmen war ein ungenügender Ausweg. Ich verlangte mehr: der Zuschauer sollte wirklich von einem Ort zum anderen geführt werden. So kam ich auf die dreiteilige Bühne. Eine sehr breite Bühnenöffnung - breiter als der Zuschauerraum selbst - erlaubte die Anlage einer Mittel- und zweier Seitenbühnen, die variiert werden konnten. Die mittlere Bühne hatte die normale Breite. Die beiden Seitenbühnen waren für Episoden und Szenen geringeren Umfangs breit genug. Die Mittelbühne lag axial zum | |
[pagina 357]
| |
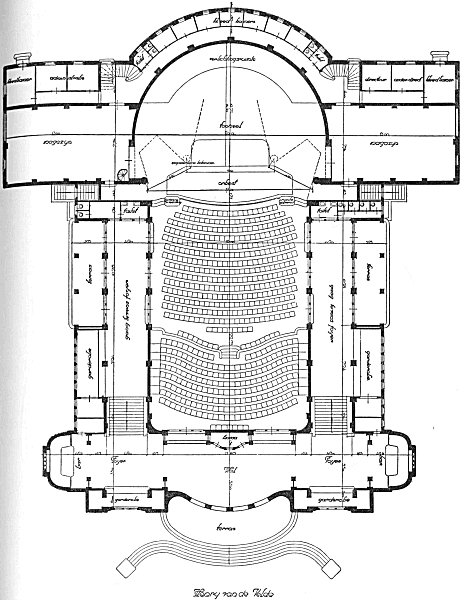
102 Grundriß des Werkbundtheaters in Köln, 1914
| |
[pagina 358]
| |
Zuschauerraum, die Seitenbühnen waren mit Rücksicht auf die Sicht leicht abgewinkelt. Zwei zylindrische Rohre, die nach Bedarf entfernt werden konnten, trennten die drei Schauplätze. Die Einteilung in diese drei Bühnen war das Normale; bei Entfernung der Rohre konnte die Bühne in voller Breite als ein einziger Schauplatz verwendet werden. Die Anlage der Bühne und ihr Verhältnis zum Zuschauerraum gewährleisteten eine ungestörte Sicht von allen Plätzen des Zuschauerraumes aus. Sie ermöglichte den ununterbrochenen Ablauf der dramatischen Handlung. Soviel ich weiß, wurde im Münchner Prinzregententheater der erste Leinwandhorizont verwendet. Der frühere flache Hintergrund verwandelte sich in den Rundhorizont, der den Eindruck eines unendlichen Luftraums hervorruft. Aber die unvermeidbaren Falten, die sich durch die auf der Kurve der Schiene laufenden Ringe ergeben, an denen der Rundhorizont aufgehängt ist, haben immer die Wirkung geschädigt. Um diesen häßlichen Nachteil auszuschalten, konstruierte ich für das Kölner Theater eine massive kreisförmige Mauer, deren Radius ich so anlegte, daß die vorderen Enden des Segmentes weiter auseinanderlagen als die gesamte Breite der dreiteiligen Bühne. Diese Anordnung behinderte in keiner Weise die Zugänge zur Bühne und zum Proszenium, das bei gewissen Aufführungen als viertes Spielfeld verwendet werden konnte. Ich suchte auch die unpraktische Lage der Orgel zu verbessern, die gewöhnlich auf einer Seite der Bühne eingebaut war. Der Orgelklang darf nicht von weit her kommen; das Instrument muß unmittelbar über dem Bühnenrahmen angebracht werden. An dieser Stelle sah ich auch eine Galerie vor, auf der bei Balletten ein kleines Orchester untergebracht werden konnte. Die auf jede hinderliche Maschinerie verzichtende Bühne des Werkbundtheaters wurde Gegenstand lebhafter Diskussionen und Kritiken. Sie wurde aber auch gelobt. Ernst Hardt, der sie mit den Augen des dramatischen Dichters und kommenden Intendanten beurteilte, veröffentlichte im ‘Berliner Tageblatt’ ein langes Feuilleton unter dem Titel ‘Die neue Bühne, Gedanken über Henry van de Veldes Theater’, in dem sich der Satz findet: ‘Ich habe niemals vor einer Bühne ein so tiefes Gefühl für die hinter dem Vorhang wesende Welt eines Dramas gehabt wie hier.’ Ich selbst wohnte den Aufführungen einer Reihe von Dramen und Opern bei, unter denen, | |
[pagina 359]
| |
neben Goethes ‘Faust’, Byrons ‘Manfred’ und Mozarts ‘Entführung aus dem Serail’, von der Münchner Hofoper unter musikalischer Leitung Bruno Walters aufgeführt, die Tanzabende von Clotilde von Derp und Alexander Sacharoff mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Als Folge der plötzlichen Kriegserklärung Anfang September 1914 schloß das Theater für immer seine Pforten. Mit dem Werkbundtheater kämpfte ich einerseits für ein neues Bühnenprinzip, das auf die einfachsten szenischen Grundlagen zurückgriff, andrer-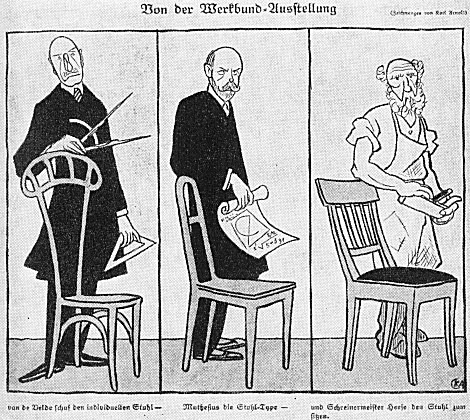
103 Karikatur von Karl Arnold zur Kölner Werkbund-Diskussion, 1914
| |
[pagina 360]
| |
seits für eine architektonische Gestaltung des Theaterbaus, bei der ich die äußersten Konsequenzen der vernunftgemäßen Konzeption gezogen hatte und ästhetische Eindrücke zu verwirklichen versuchte, deren überraschende Schönheit nach meiner Überzeugung dem Wesen des Theaters gemäß ist. Im Trubel dieser bewegten Kölner Wochen kamen mir wieder einmal die Rolle, die mir das Schicksal zugewiesen hatte, und die Stellung zum Bewußtsein, die ich mir in Deutschland in der nunmehr weit ausgebreiteten künstlerischen Bewegung geschaffen hatte, deren Ziel die Eroberung eines ‘Neuen Stils’ war. | |
Werkbund-DiskussionUnter den Beteiligten der Werkbundausstellung hatte sich eine starke Gruppe gebildet, die gegen dieses Prinzip vernunftgemäßer und konsequenter Konzeption Opposition machte. Für sie bedeutete seine Anwendung eine Hemmung der Vorstellungskraft, die sie in jene Richtung zog, in der die undisziplinierte Phantasie zu allen Zeiten verlockende Produkte hervorbrachte, die ein abgestumpftes Publikum zum Kauf verführen. Eine zweite Gruppe sah in diesem Prinzip eine unschätzbare Hilfe, eine fruchtbare Quelle zur Entwicklung neuer Dinge. Einer dritten und stärksten Gruppe erschienen die verstockten Vertreter der Phantasie ebenso gefährlich wie die unbeirrten Individualisten, die meine Meinung teilten. In uns, als den Repräsentanten des linken Flügels, sah die Gruppe der ‘goldenen Mitte’, die neo-biedermeierlichen Tendenzen huldigte, die größere Gefahr. Das mag normal scheinen; auch in der Politik und der sozialen Entwicklung ist es nie anders gewesen. In diesem besonderen Fall, in dem das die Neutralität verkörpernde Typenprodukt durchgesetzt werden sollte, trat eine außergewöhnliche Kurzsichtigkeit in Erscheinung. Ist es nicht gefährlicher, dem Publikumsgeschmack durch Reminiszenzen und Pikanterien verflossener Stilepochen zu schmeicheln, als den Versuch des Künstlers zu billigen, der die Bindungen der Neutralität sprengt, um seinem künstlerischen Empfinden freien Lauf zu lassen? Aber die Mehrheit, eben ‘die goldene Mitte’, war der Meinung, daß Künst- | |
[pagina *57]
| |
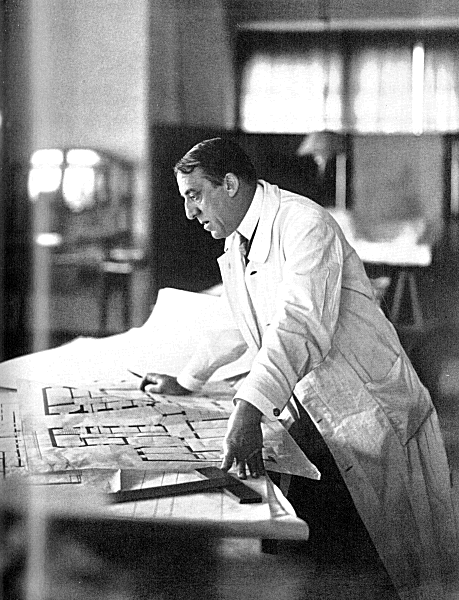
104 Henry van de Velde im Weimarer Atelier, um 1911, auf dem Tisch Plan zum Pastorat in Riga
| |
[pagina *58]
| |
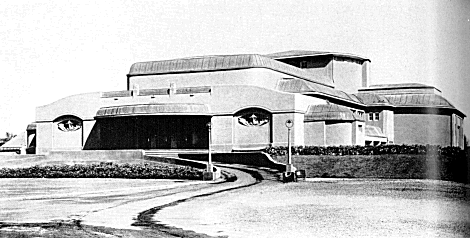
105/106 Werkbundtheater Köln, 1914
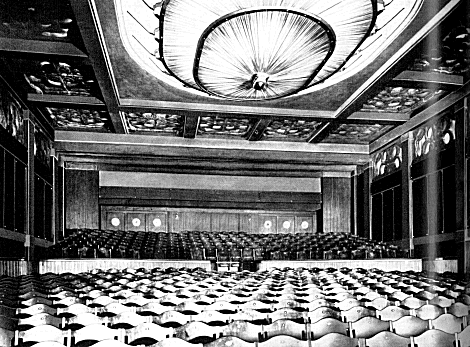
107/109 Drei Varianten der dreifachen Bühne des Werkbundtheaters. Bühnenbilder zu ‘Faust I’
| |
[pagina *59]
| |
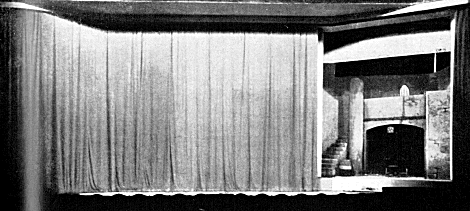  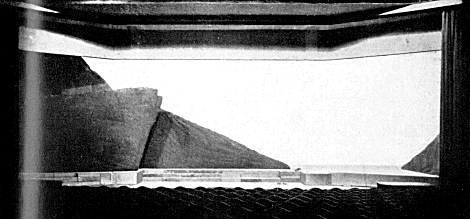 | |
[pagina *60]
| |
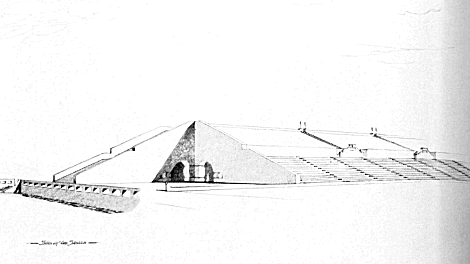 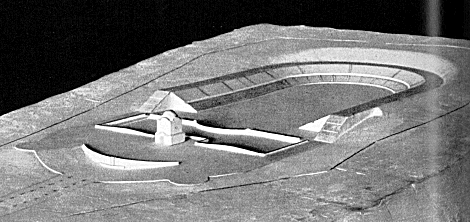
110/111 Das geplante Nietzsche-Denkmal für Weimar, 1912
| |
[pagina 361]
| |
ler wie Hermann Obrist, August Endell, Bruno Taut, Walter Gropius und ich die Zukunft des Werkbundes mehr gefährdeten. Sie glaubten, der Werkbund sollte eine ‘ruhige’ Institution sein. Dementsprechend hatte die große Mehrheit des Vorstandes jede Gelegenheit benutzt, den öffentlichen Stellen, an deren Mitarbeit und Unterstützung appelliert wurde, die gewünschten Zusicherungen zu geben. Auch die großen Industriefirmen verlangten Beweise der Mäßigung. Aber die Ausstellung, die einen Überblick über die Leistungen des Werkbundes seit seiner Gründung geben sollte, zeigte beträchtliche ‘Schönheitsfehler’ infolge einiger mutiger persönlicher Leistungen, die der allgemein gewünschten neutralen Mittelmäßigkeit nicht entsprachen. Die Mehrheit der Werkbundmitglieder war mit der Meinung des Architekten Hermann Muthesius einverstanden, der im Vorstand eine bedeutende Rolle spielte. Für ihn war der Zeitpunkt gekommen, an dem die individuelle Arbeit aufzugeben und an ihre Stelle allgemeine Regeln, ein ‘Kanon’ für die architektonische und kunstgewerbliche Produktion zu setzen seien. Muthesius hatte die Absicht, bei der Kölner Werkbundtagung die Zustimmung zur ‘Typisierung’ als Leitgedanken für die zukünftige Arbeit des Werkbundes zu erreichen. Die Gründe, die die großen Firmen und viele Architekten veranlaßten, Muthesius zu folgen und die ‘ewigen Experimente’ zu bremsen, waren nicht schwer zu erkennen. Sie entsprangen dem persönlichen Interesse, das endlich die Ernte eingebracht wissen wollte. Nach zwanzig Jahren des Suchens und der Unsicherheiten sollte endlich Stabilität geschaffen werden. Wir indessen fühlten uns mehr als je in unserer Freiheit bedroht, mit der wir unsere Ziele verfolgen wollten. Es wäre die Bankerotterklärung des Gedankens eines ‘Neuen Stils’ gewesen, wenn wir nicht mit allen unseren Kräften gegen das Rezept der ‘Typisierung’ protestiert hätten. Die Gruppe, die sich in der Werkbundleitung durchsetzen wollte, war einem in Deutschland vorherrschenden Glauben verfallen: dem Glauben an die Allmacht der Organisation! Ihm zufolge wird die organisierte Impotenz durch die Macht des aufgezwungenen Willens zur Potenz. Einige Tage vor der Eröffnung der Werkbundtagung, die vom 2. bis 6. Juli 1914 stattfand, wurden den Mitgliedern zehn von Muthesius verfaßte Leitsätze unterbreitet, die als Grundlage für die weitere Arbeit des Werkbun- | |
[pagina 362]
| |
des dienen sollten. Am Abend vor der Eröffnung stellte ich zu meiner großen Überraschung fest, daß viele Mitglieder wie ich selbst empört waren, sich der Mehrheit unterwerfen zu sollen. Nach einem Gedankenaustausch beschloß unsere Gruppe, energisch gegen die Annahme der zehn Leitsätze von Muthesius zu protestieren. Ich wurde spontan beauftragt, in öffentlicher Erklärung unseren Standpunkt dem Opportunismus einer Majorität entgegenzusetzen, die weder das Recht hatte zu befehlen, noch unseren Weg zu blockieren, den wir noch nicht zu Ende gegangen waren. Am Abend nach der Eröffnungssitzung trafen sich meine Freunde Obrist, Endell, Osthaus, Breuer, Taut und ich in der Halle des Hotels ‘Excelsior’, wo wir alle wohnten, und diskutierten die Frage, wie wir uns zum Vorgehen von Muthesius stellen sollten. Wir beschlossen, uns gegen seine unerhörte Herausforderung zu wehren. Aber wir hatten nur eine Nacht zur Verfügung, um zehn Gegenleitsätze zu formulieren, den französischen Text ins Deutsche zu übersetzen, ihn drucken zu lassen und rechtzeitig, das heißt vor der Sitzung des kommenden Morgens, an die Mitglieder zu verteilen. Weitere Gegner der Vorschläge von Muthesius schlossen sich uns an. Während des Nachtessens, bei dem wir uns in sehr angeregter, kampflustiger Stimmung befanden, verteilten wir die Rollen für die Arbeit, die noch geleistet werden mußte, bevor wir uns schlafen legen konnten, um für den nächsten Tag gerüstet zu sein. In einem kleinen Saal, den uns der Hoteldirektor zur Verfügung stellte, brachte ich die zehn knapp gefaßten, radikalen Gegenleitsätze zu Papier. Hermann Obrist und Else von Guaita, die beide ausgezeichnet Französisch sprachen, hielten sich zur Übersetzung bereit. Abschnittweise übergab ich meine Aufzeichnungen meinen Übersetzern. Else von Guaita entzifferte die handschriftlichen Texte, zu denen Obrist die eine oder andere Änderung vorschlug. Endell und Taut hielten die Verbindung zu dem Drucker aufrecht, der während der Nacht zwei oder drei Setzer in seiner Werkstatt zur Verfügung hielt. Dank der vielen Kaffee-Kirsch, die uns Else von Guaita vorsetzte, blieben wir frisch, und um zwei Uhr nachts brachte Taut oder Endell den Text des zehnten Gegenleitsatzes in die Druckerei. Er kehrte mit dem Taxi zurück und brachte die Korrekturabzüge, die ich noch in Ordnung bringen konnte. Während der ganzen Nacht rollte ferner Donner, so daß wir uns fragten, ob ein neues Unwetter heraufzog, | |
[pagina 363]
| |
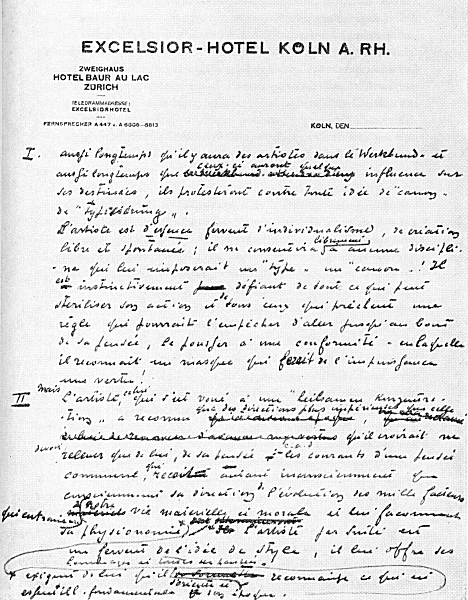
112 Französisches Manuskript van de Veldes für die Kölner ‘Gegenleitsätze’, 1914
| |
[pagina 364]
| |
ähnlich jenem, das im vergangenen Monat beim Werkbundtheater soviel Unheil angerichtet hatte. Am nächsten Morgen wurden den Werkbundmitgliedern meine Gegenleitsätze ausgehändigt. Muthesius erhielt als erster das Wort. Nach einer kurzen Ansprache erklärte er, daß er seine Leitsätze in seinem eigenen Namen zur Abstimmung vorlege. Seine Leitsätze lauteten: ‘1. Die Architektur und mit ihr das ganze Werkbundschaffensgebiet drängt nach Typisierung und kann nur durch sie diejenige allgemeine Bedeutung wiedererlangen, die ihr in Zeiten harmonischer Kultur eigen war. 2. Nur mit der Typisierung, die als Ergebnis einer heilsamen Konzentration aufzufassen ist, kann wieder ein allgemein geltender, sicherer Geschmack Eingang finden. 3. Solange eine geschmackvolle Allgemeinhöhe nicht erreicht ist, kann auf eine wirksame Ausstrahlung des deutschen Kunstgewerbes auf das Ausland nicht gerechnet werden. 4. Die Welt wird erst dann nach unseren Erzeugnissen fragen, wenn aus ihnen ein überzeugender Stilausdruck spricht. Für diese hat die bisherige deutsche Bewegung die Grundlage geschaffen. 5. Der schöpferische Weiterausbau des Errungenen ist die dringendste Aufgabe der Zeit. Von ihr wird der endgültige Erfolg der Bewegung abhängen. Jedes Zurück- und Abfallen in die Nachahmung würde heute die Verschleuderung eines wertvollen Besitzes bedeuten. 6. Von der Überzeugung ausgehend, daß es für Deutschland eine Lebensfrage ist, seine Produktion mehr und mehr zu veredeln, hat der Deutsche Werkbund als eine Vereinigung von Künstlern, Industriellen und Kaufleuten sein Augenmerk darauf zu richten, die Vorbedingungen für einen kunstindustriellen Export zu schaffen. 7. Die Fortschritte Deutschlands in Kunstgewerbe und Architektur sollten dem Auslande durch eine wirksame Propaganda bekanntgemacht werden. Als nächstliegendes Mittel hierfür empfehlen sich neben Ausstellungen periodische illustrierte Veröffentlichungen. 8. Ausstellungen des Deutschen Werkbundes haben nur dann Sinn, wenn sie sich grundsätzlich auf Bestes und Vorbildliches beschränken. Kunstgewerbliche Ausstellungen im Auslande sind als eine nationale Angelegenheit zu betrachten und bedürfen daher öffentlicher Unterstützung. | |
[pagina 365]
| |
9. Für einen etwaigen Export ist das Vorhandensein leistungsfähiger und geschmacklich sicherer Großgeschäfte die Vorbedingung. Mit dem vom Künstler für den Einzelfall entworfenen Gegenstand würde nicht einmal der einheimische Bedarf gedeckt werden können. 10. Aus nationalen Gründen sollen sich große, nach dem Ausland arbeitende Vertriebs- und Verkehrsgesellschaften jetzt, nachdem die Bewegung ihre Früchte gezeitigt hat, der neuen Bewegung anschließen und die deutsche Kunst mit Bewußtsein in der Welt vertreten.’
Nach Muthesius erhielt ich als nächster das Wort und ging sofort zum Angriff über. Draußen tobten Blitz und Donner. Nach einer kurzen, scharfen Einleitung verlangte ich für die Künstler des Werkbundes das Recht zu freier, unabhängiger, schöpferischer Arbeit, die durch kein einengendes Programm bedroht werden dürfe. Die Idee der Beschränkung auf ‘Typen’, die von einer Kommission festgelegt werden sollten, bezeichnete ich als das traurige, verabscheuungswürdige Ende einer Vereinigung, die von uns alles erwarten dürfe, nur keine Entmannung. Dann verlas ich in schneidendem, schroffem Ton unsere zehn Gegenleitsätze: ‘1. Solange es noch Künstler im Werkbund geben wird und solange diese noch einen Einfluß auf dessen Geschicke haben werden, werden sie gegen jeden Vorschlag eines Kanons oder einer Typisierung protestieren. Der Künstler ist seiner innersten Essenz nach glühender Individualist, freier spontaner Schöpfer; aus freien Stücken wird er niemals einer Disziplin sich unterordnen, die ihm einen Typ, einen Kanon aufzwingt. Instinktiv mißtraut er allem, was seine Handlungen sterilisieren könnte, und jedem, der eine Regel predigt, die ihn verhindern könnte, seine Gedanken bis zu ihrem eigenen freien Ende durchzudenken, oder die ihn in eine allgemeingültige Form hineintreiben will, in der er doch nur eine Maske sieht, die aus einer Unfähigkeit eine Tugend machen möchte. 2. Gewiß hat der Künstler, der eine ‘heilsame Konzentration’ treibt, immer erkannt, daß Strömungen, die stärker sind als sein einzelnes Wollen und Denken, von ihm verlangen, daß er erkenne, was wesentlich seinem Zeitgeiste entspricht. Diese Strömungen können sehr vielfältige sein, er nimmt sie unbewußt und bewußt als allgemeine Einflüsse auf, sie haben materiell und moralisch etwas für ihn Zwingendes; er ordnet sich ihnen | |
[pagina 366]
| |
willig unter und ist für die Idee eines neuen Stils an sich begeistert. Und seit zwanzig Jahren suchen manche unter uns die Formen und die Verzierungen, die restlos unserer Epoche entsprechen. 3. Keinem von uns ist es jedoch eingefallen, diese von uns gesuchten oder gefundenen Formen oder Verzierungen anderen nunmehr als Typen aufzwingen zu wollen. Wir wissen, daß mehrere Generationen an dem noch arbeiten müssen, was wir angefangen haben, ehe die Physiognomie des neuen Stils fixiert sein wird, und daß erst nach Verlauf einer ganzen Periode von Anstrengungen die Rede von Typen und Typisierung sein kann. 4. Wir wissen aber auch, daß nur solange dieses Ziel nicht erreicht ist, unsere Anstrengungen noch den Reiz des schöpferischen Schwunges haben werden. Langsam fangen die Kräfte, die Gaben aller an, ineinander überzugehen, die Gegensätze werden neutralisiert, und eben in dem Augenblick, wo die individuellen Anstrengungen anfangen, zu erlahmen, wird die Physiognomie fixiert. Die Ära der Nachahmung fängt an, und es setzt der Gebrauch von Formen und von Verzierungen ein, bei deren Herstellung niemand mehr den schöpferischen Impuls aufbringt: die Zeit der Unfruchtbarkeit ist dann eingetreten. 5. Das Verlangen, einen Typ noch vor dem Werden eines Stiles erstehen zu sehen, ist geradezu dem Verlangen gleichzusetzen, die Wirkung vor der Ursache sehen zu wollen. Es heißt, den Keim im Ei zerstören. Sollte wirklich jemand sich durch den Schein, damit rasche Resultate erzielen zu können, blenden lassen? Diese vorzeitigen Wirkungen haben um so weniger Aussicht, eine wirksame Ausstrahlung des deutschen Kunstgewerbes auf das Ausland zu erreichen, als eben dieses Ausland einen Vorsprung vor uns voraus hat in der alten Tradition und der alten Kultur des Geschmackes. 6. Deutschland hingegen hat den großen Vorzug, noch Gaben zu haben, die anderen älteren, müderen Völkern abgehen, die Gaben der Erfindung nämlich, der persönlichen geistreichen Einfälle. Und es heißt geradezu, eine Kastration vorzunehmen, wenn man diesen reichen, vielseitigen, schöpferischen Aufschwung jetzt schon festlegen will. 7. Die Anstrengungen des Werkbundes sollten dahin abzielen, gerade diese Gaben sowie die Gaben der individuellen Handfertigkeit, die Freude und den Glauben an die Schönheit einer möglichst differenzierten Ausführung zu pflegen und nicht sie durch eine Typisierung zu hemmen, gerade | |
[pagina 367]
| |
in dem Momente, wo das Ausland anfängt, an deutscher Arbeit Interesse zu finden. Auf dem Gebiete dieser Förderung bleibt fast noch alles zu tun übrig. 8. Wir verkennen niemandes guten Willen und erkennen sehr wohl die Schwierigkeiten, die dabei zu überwinden sind. Wir wissen, daß die Arbeiterorganisation sehr viel für das materielle Wohl des Arbeiters getan hat, aber kaum eine Entschuldigung dafür vorbringen kann, so wenig dafür getan zu haben, die Begeisterung für vollendet schöne Arbeit bei denen zu wecken, die unsere freudigsten Mitarbeiter sein müßten. Andererseits ist uns der Fluch wohlbekannt, der auf unserer Industrie lastet, exportieren zu müssen. 9. Und dennoch ist nie etwas Gutes und Herrliches geschaffen worden aus bloßer Rücksicht auf den Export. Qualität wird nicht aus dem Geiste des Exports geschaffen. Qualität wird immer nur zuerst für einen ganz beschränkten Kreis von Auftraggebern und Kennern geschaffen. Diese bekommen allmählich Zutrauen zu ihren Künstlern, langsam entwickelt sich erst eine engere, dann eine rein nationale Kundschaft, und dann erst nimmt das Ausland und die Welt langsam Notiz von dieser Qualität. Es ist ein vollkommenes Verkennen des Tatbestandes, wenn man die Industriellen glauben macht, sie vermehrten ihre Chancen auf dem Weltmarkt, wenn sie A priori-Typen produzierten für diesen Weltmarkt, ehe diese ein zu Hause ausprobiertes Gemeingut geworden sind. Die wundervollen Werke, die jetzt zu uns exportiert werden, sind niemals ursprünglich für den Export erschaffen worden, man denke an Tiffany-Gläser, Kopenhagener Porzellan, Schmuck von Jensen, die Bücher von Cobden-Sanderson und so weiter. 10. Jede Ausstellung muß das Ziel verfolgen, der Welt diese heimische Qualität zu zeigen, und die Ausstellungen des Werkbundes haben in der Tat nur dann einen Sinn, wenn sie sich, wie Herr Muthesius so trefflich sagt, grundsätzlich auf Bestes und Vorbildliches beschränken.’
Die in mir aufgestaute tiefe Entrüstung muß sich in meiner Stimme und meiner Haltung auf dem Podium ausgeprägt haben; ein Berichterstatter charakterisierte sie mit den Worten: ‘der Mensch ganz aus Stahl’. Die Wirkung meiner Gegenleitsätze war beträchtlich. Ich ‘deklamierte’ sie | |
[pagina 368]
| |
gleichsam, und je weiter ich im Text, der an die Anwesenden verteilt worden war, kam, desto mehr sah ich mich gezwungen, meine Stimme zu erheben. Denn genau in dem Augenblick, in dem ich aufstand und zu lesen begann, brach ein heftiges Gewitter aus, dessen Donnerschläge meinen Sätzen Nachdruck verliehen. Ich habe viel in der Öffentlichkeit gesprochen. Nie aber habe ich eine derartige Erregung verspürt wie bei der ‘Deklamation’ dieses ‘Credo’ des Künstlers, der seine heiligsten Rechte gegen eigennützige, opportunistische Kräfte verteidigt, die nur darauf bedacht sind, materiellen Profit einzuheimsen und Weltmärkte zu erobern. Während ich meine Sätze Wort für Wort gleichsam skandierte, spürte ich, wie ihr Sinn in den Geist der Zuhörer eindrang und in ihnen Gefühle erweckte, die sie wider ihren Willen dazu brachten, die Richtigkeit unserer Leitsätze anzuerkennen, und daß sie die Klarheit unseres Programms und den Stolz unserer ausdrücklichen Erklärung achteten, uns unter keinen Umständen zu unterwerfen. Allen wurde klar, daß wir eher mit dem Werkbund brechen würden, eine Lösung, die niemand wünschte. Die Fackel war entzündet, das Feuer brannte, und das draußen tobende Gewitter verstärkte die Unruhe, die die Versammlung erfaßt hatte. Die scharfe Kritik und Ironie meines letzten Gegenleitsatzes hatte zur Folge, daß sich alle, die sich getroffen fühlten, gegen mich wendeten. Unter der Majorität entstand eine gewisse Verblüffung, während sich meine Anhänger erhoben und die Zurücknahme der ‘offiziellen’ Leitsätze von Muthesius verlangten. Der Architekt Peter Behrens eröffnete den Reigen der Redner. Er stellte sich auf meine Seite, allerdings in der etwas vagen Art, die in seinen Meinungen wie in seinen Werken zum Ausdruck kam. Gropius verzichtete auf eine ausführliche Erklärung zugunsten August Endells, der mit Überzeugung und lebhaftem Enthusiasmus unsere Sache vertrat. Ostwald stellte sich auf die Seite von Muthesius. Riemerschmid, Obrist, Karl Ernst Osthaus und Robert Breuer, der junge, brillante Kunstkritiker, entwickelten jeder auf seine Weise die Argumente gegen die ‘Typisierung’ und für die schöpferische Freiheit. Der Radikalismus, mit dem der junge Architekt Bruno Taut die Sterilität der Typisierung angriff, brachte die Muthesius-Anhänger, die offensichtlich in der Minderheit waren, in Aufruhr. Leidenschaftlich erklärte Taut, es sei unwichtig, ob in einer Saison das Dreieck | |
[pagina 369]
| |
und in der nächsten das Quadrat als einzig richtige Ornamente dekretiert würden. Nur die schöpferischen Anstrengungen und die Überlegungen derer, die klar sähen, seien für die Zukunft des Deutschen Werkbundes entscheidend. Das Wort ‘Diktator’ und der Ruf nach ‘Diktatur’ waren dem ungestümen Bruno Taut, der die Fahne des Aufruhrs hochhielt, ohne Zweifel entschlüpft, ohne daß er sich die Konsequenzen klarmachte. Während er sich im Tumult Gehör zu verschaffen suchte, rief er aus: ‘Ich glaube, die Gegenleitsätze van de Veldes sollten das Programm des Werkbundes werden, und ich schlage vor, seiner Autorität eine Diktatur zu übertragen!’ Die Anwesenden sprangen auf, und in unerhörtem Lärm prallten die entgegengesetzten Meinungen aufeinander. Breuer konnte für wenige Augenblicke den Lärm zum Schweigen bringen und versuchte, den genauen Sinn der Begriffe ‘Diktatur’ und ‘Diktator’ zu erklären. Später beim Nachtessen machte ich Taut auf die Inkonsequenz seiner Ausführungen aufmerksam. Die Idee einer Diktatur sei unvereinbar mit der Idee eines freien, schöpferischen Schaffens. Auf seiten der Anhänger einer Typisierung seien diktatorische Neigungen viel eher zu befürchten. Die Festlegung von Typen bedeute den ersten Schritt zur Diktatur. Im Verlauf unseres Gesprächs zog sich Taut auf eine besser zu verteidigende Position zurück. Hinter seiner Forderung stand der Wunsch nach einer Führung, welche die einzelnen Vorkämpfer einer Bewegung zusammenfaßte, die ihre Kräfte bisher in individuellen Anstrengungen vergeudeten. Muthesius konnte sich keine Illusionen mehr machen, nachdem ein neutraler Redner festgestellt hatte, daß bei einer Abstimmung über die Leitsätze das ‘Für’ und ‘Wider’ sich bestenfalls die Waage halten würden. Es bestand kein Zweifel, daß eine Spaltung drohte, bei der der Werkbund seine schöpferischen Mitglieder verloren hätte. In dieser Situation hielt Muthesius eine lange, resignierte Schlußrede, bei der man beinahe Mitleid mit ihm empfand, weil er sein persönliches Opfer und seine Treue zum Werkbund allzusehr betonte. Das Opfer bestand in der klaren Zurücknahme seiner Vorschläge. Einmütiger Beifall bestätigte die allgemeine Befriedigung. Die einen waren über die verhinderte Spaltung erfreut, die anderen triumphierten über die Niederlage des Gedankens einer Typisierung und Gleichmacherei. Bevor sich die Versammlung trennte, erklärte der Präsident, die beiden | |
[pagina 370]
| |
Tage seien nicht negativ verlaufen; die Sitzungen hätten eine freie Aussprache der Meinungen, ein ‘Aufeinanderplatzen der Geister’ ermöglicht. Er schloß mit den Worten: ‘Es war mit unseren Verhandlungen wie mit dem Wetter. Als wir eintraten, lag eine gewisse Schwüle in der Luft, und wie draußen die Schwüle durch ein richtiges Donnerwetter beseitigt ist, so hoffe ich, daß auch in unseren Reihen die Stimmung wesentlich geklärt ist.’ Die Kölner Tage bestätigten meine Rolle als Haupt der Bewegung in Deutschland. Sie war das Ergebnis meiner 1893 begonnenen Bestrebungen, an deren Beginn mein erster Vortrag im Kreis der ‘Libre Esthétique’ in Brüssel und meine ersten Kurse an der Antwerpener Akademie standen und die ich in Deutschland weiterführte. | |
Zweifel nach allen SeitenEs mag dem Leser aufgefallen sein, daß ich in meinen Gegenleitsätzen die deutsche Industrie und das Kunstgewerbe als ‘unsere’ Industrie und als ‘unser’ Kunstgewerbe bezeichnet habe, obgleich ich selbst nicht Deutscher war. Ich habe mich nie naturalisieren lassen. Nie habe ich den Wunsch gehabt, meine Nationalität zu wechseln, und nie wurde ich - vor dem Krieg - aufgefordert, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. Für alle, die mich in Deutschland kannten, war ich ‘der Belgier van de Velde’. Aber zugleich galt es als selbstverständlich, daß ich damals zu den Deutschen gehörte. Und dies in einem solchen Maße, daß ich während der Zeit meines Aufenthaltes in Deutschland, das heißt seit Oktober 1900, zur Teilnahme an allen nationalen Ausstellungen eingeladen wurde. Ich war Mitglied des Werkbundvorstandes, und bei der vom ‘Deutschen Künstlerbund’ 1906 in London veranstalteten Ausstellung wurde mir ihre Einrichtung übertragen. Es fiel mir sogar zu, öffentlich - in französischer Sprache - den englischen Künstlern für die Ehrung der deutschen Gäste zu danken. Obwohl ich mich durch viele und intime Bande mit Deutschland verknüpft fühlte, war ich zweimal nahe daran, sie zu lösen. Das erste Mal 1912, als ich mir in Paris ein Atelier und eine Wohnung einrichtete, und ein zweites Mal 1913 anläßlich einer Reihe von Vorträgen, zu denen mich | |
[pagina 371]
| |
die Universität Brüssel einlud. Damals nahm ich nach dreizehnjährigem Aufenthalt im Ausland die Verbindung mit meinem Heimatland, meinen Verwandten und belgischen Freunden wieder auf. Gewiß: mein Werk und mein Name waren in Deutschland groß geworden, meine Autorität hatte sich dort durchgesetzt, und meine materielle Existenz war reichlich gesichert. Ich hatte ein Heim, in dem die Kinder heranwuchsen. Im Garten vermehrten sich die Blumen, die meine Frau mit Liebe und Sorgfalt pflegte. Die Bäume standen voller Früchte, und ihr Astwerk verbreitete sich in dichtem Gewirr. Mit den Einwohnern von Ehringsdorf standen wir in herzlichsten Beziehungen, die Behörden, das heißt der Bürgermeister und der Gemeindediener, waren so zuvorkommend, daß sie sich sogar um die Beleuchtung der Straße vor unserem Hause kümmerten, wenn wir Gäste hatten. Trotz alledem kamen mir manchmal Zweifel an den Entwicklungsmöglichkeiten der Bewegung in Deutschland, der ich mein Leben gewidmet hatte, und auch hinsichtlich der Zukunft meiner Kinder. Bei diesen beiden Dingen ging es um Fragen der Assimilation, der sich, wie mir schien, Probleme der Mentalität und Sensibilität entgegenstellten. Zwischen uns und unseren Freunden herrschte vollkommene Harmonie der Gefühle und Ansichten. Aber im Laufe der fortschreitenden Entwicklung meiner Kinder beobachtete ich Äußerungen und Reaktionen, auf Grund derer ich mich fragte, ob sie sich je mit ihrer Umgebung in wahren Einklang würden setzen könne. Meine Zweifel bezogen sich vor allem auf bestimmte soziale Konventionen, denen sich zu fügen schwerfiel und unter denen unsere Kinder gegebenenfalls zu leiden haben würden. Damals wurden in Deutschland ungetaufte Kinder wie die unsrigen noch schief angesehen, und bei vielen Gelegenheiten ließ man sie es fühlen, daß sie Ausländer waren. Und was meine Kunsttheorie, meine Vorstellung von der Schönheit und vor allem das Prinzip der vernunftgemäßen Gestaltung betraf, so hatte ich gewichtige Gründe anzunehmen, daß sie in Deutschland noch lange nicht, vielleicht nie Allgemeingut werden würden. Die psychologische Reaktion, aus der sich meine Theorien entwickelt haben, ebenso wie die Voraussetzungen meiner strukto-linearen, dynamographischen Ornamentik sind im Grund der germanischen Rasse fremd, deren Phantasie immer stärker war als ihre Sensibilität. Auch das ‘Leben | |
[pagina 372]
| |
des Stoffes’ und das ‘psychologische Verständnis’ für das Architektonische liegen dem lateinischen Wesen, das dem hellenischen so viel verdankt, näher. Mein Einfluß und meine Lehre, so erschien es mir mehr und mehr, würden in Deutschland fremd bleiben und ich selbst samt meinen Schülern Ausnahmen, ja Ausländer. Meine Versuche, mich in Paris niederzulassen oder nach Belgien zurückzukehren, gelangten nicht zum Ziel. Als ich mich auf Drängen von Maurice Denis im Hinblick auf meine Arbeiten für das ‘Théâtre des Champs-Elysées’ bereit erklärte, mich vorübergehend in Paris festzusetzen, machte ich weder ihm noch dem Präsidenten Thomas gegenüber ein Hehl daraus, welche Hoffnungen ich an diese Arbeit knüpfte. Beide versicherten mir, daß sie meine Wünsche teilten, und versprachen, mir zu helfen. Aber beide haben mich unter sehr häßlichen Umständen verraten. Über die Schwierigkeiten, die meiner Rückkehr nach Belgien und meinem Wunsch nach einer offiziellen Funktion dort entgegenstanden, war ich mir klar. Der besonders begeisterte Empfang, den mir die Studenten und Hörer meiner Vorlesungen an der ‘Université Nouvelle’ in Brüssel im Mai 1913 bereiteten, hatte mich trotzdem ermutigt, diese Möglichkeit ins Auge zu fassen und bei einflußreichen Freunden entsprechende Schritte zu unternehmen. Emile Verhaeren, Octave Maus und Emile Vandervelde kannten meinen Wunsch und die Gründe, die mir den Gedanken nahelegten, Weimar zu verlassen und nach Belgien zurückzukehren. Ich bin überzeugt, daß sie alle nur denkbaren Schritte unternommen haben; aber es war nicht möglich. Durch meinen Freund Charles Lefébure, der stets mit größtem Interesse meine Entwicklung in Deutschland verfolgte, erfuhrich, daß die belgische Regierung nicht in der Lage war, mir eine auch nur ähnliche Stellung zu bieten, wie ich sie in Deutschland einnahm, da die finanziellen Mittel zur Errichtung einer Schule und anderer Institutionen, die ich in der kleinen Residenz Sachsen-Weimars geschaffen hatte, nicht zur Verfügung gestellt werden konnten. Der Brief, der diese Nachricht enthielt, wurde mir in Köln in den Tagen zugestellt, in denen die Vollendung des Werkbundtheaters übermenschliche Arbeit von mir verlangte. | |
[pagina 373]
| |
Rücktritt, Kriegsbeginn und Ende der Weimarer ZeitIn Weimar erfuhr ich durch meinen treuen Mitarbeiter Hugo Westberg, daß im ‘Kunstverein’ davon gesprochen wurde, der Großherzog empfange persönlich die Kandidaten für meine Nachfolge. Unter ihnen befand sich der mir feindlich gesinnte Professor Paul Schultze-Naumburg, der wie die anderen Kandidaten der ‘Neo-Biedermeier-Richtung’ angehörte. Der Großherzog wünschte, daß dieser sogenannte Stil offiziell zur Grundlage des Unterrichts an der Kunstgewerbeschule erklärt werde. Zugleich erwartete er die Übernahme meines Institutes durch den Staat. Unter diesen Umständen reichte ich durch Vermittlung des Oberhofmarschalls am 15. Juli 1914 beim Großherzog mein Entlassungsgesuch ein. Die Nachricht machte die Runde durch die Presse, deren ausgiebige Kommentare sehr verschieden waren. Meine Mitarbeiter aus den Kreisen des Kunstgewerbes und der Industrie brachten ihre Enttäuschung zum Ausdruck. Ihre Befürchtungen, daß mein Weggang von Weimar materielle Folgen für sie haben würde, suchte ich mit dem Hinweis zu zerstreuen, daß Graf Kessler trotz der schmählichen Behandlung durch den Großherzog Weimar treu geblieben sei. Ich selbst konnte materiell mit einem Gefühl der Sicherheit in die Zukunft blicken.
Meine Frau und meine Kinder - ausgenommen meine älteste Tochter Nele, die von dem mir befreundeten, in Oberbayern lebenden deutsch-russischen Dichter Henry von Heiseler eingeladen worden war, die Ferien mit seiner Frau und seinen Kindern in einem baltischen Badeort unfern St. Petersburg zu verbringen - befanden sich in jenen Vorkriegstagen in Le Coq-sur-Mer am belgischen Strand in der Nähe Ostendes. Die Ermordung des österreichischen Erzherzogs Franz Ferdinand und seiner Frau hatte größte Erregung ausgelöst. Ich sehnte mich nach ein paar Ruhetagen mit meiner Familie, von der ich durch meine vielen Aufenthalte in Paris, Riga und Köln lange getrennt gewesen war. Ungeduldig verbrachte ich eine schlaflose Nacht im Schlafwagen nach Ostende und dachte über die furchtbaren Folgen nach, die sich auf Grund der Spannung zwischen Österreich-Ungarn und Serbien aus dem Attentat ergeben konnten. Während der zwölf Stunden meiner Reise hatte der Lauf der politischen | |
[pagina 374]
| |
Entwicklung zu völliger Verwirrung geführt. Die Ereignisse überstürzten sich, und das österreichische Ultimatum an Serbien ließ keinen Zweifel mehr: es bedeutete Krieg zwischen den beiden Ländern, von denen das eine, Österreich, sich des militärischen Beistands Deutschlands versichert hatte. Ein großer Teil der Sommergäste der großen und kleinen belgischen Badeorte waren Deutsche. Sie stürzten sich auf die Zeitungsstände, auf die Postämter und Bahnhöfe. Alle machten sich zur Abreise bereit. Man glaubte allerdings, Serbien sei für die vereinigten österreichisch-deutschen Armeen ein leichter Bissen. Wenn es so war, brauchte ich mich nicht zu beunruhigen. Nichts schien dagegen zu sprechen, daß wir die Ferien genossen; schlimmstenfalls müßten sie bis zum Ende des Konfliktes ausgedehnt werden. Zwei Tage nach meiner Ankunft in Le Coq-sur-Mer erhielt ich von Harry Kessler, der dank seiner Beziehungen zum Auswärtigen Amt in Berlin die Lage besser überblicken konnte, genauere und alarmierendere Nachrichten. Er riet mir, im Hinblick auf mögliche Verwicklungen die Rückreise vorzubereiten. Am nächsten Tag drängte er, sofort nach Weimar zurückzukehren. Nach einem zweiten, noch drängenderen Telegramm Harrys beschlossen wir, die Ferien abzubrechen, fuhren nach Ostende und erreichten den letzten nach Deutschland abgehenden Zug. Nervös und bedrückt, wenn auch ohne eigentliche Beunruhigung erreichten wir die deutsche Grenze, wo die peinliche Prüfung der Pässe aller Reisenden einen endlosen Aufenthalt des Zuges verursachte. Deutschland befand sich im Zustand der vollen Mobilmachung. Unser Zug mußte von Station zu Station anhalten und wurde auf Nebengleise geschoben, um Truppen-, Munitions- und Verpflegungstransporte passieren zu lassen. Auf diese Weise kamen wir mit einer Verspätung von mehr als zehn Stunden in Weimar an. Wenn ich während der Reise nicht von dem einzigen Gedanken verfolgt gewesen wäre, meine Frau und die Kinder in den Schutz unseres Hauses ‘Hohe Pappeln’ zu bringen, hätte ich bemerken müssen, daß alle uns passierenden Züge in Richtung Belgien fuhren.
Am nächsten Morgen ging ich mit Hugo Westberg in die Stadt. Auf dem großen Platz war alles in höchster Aufregung. Hunderte von requirierten Pferden aus dem ganzen Großherzogtum machten mit ihrem Wiehern und den Hufschlägen auf dem Pflaster einen unbeschreiblichen Lärm. Die Be- | |
[pagina 375]
| |
sitzer der Tiere und die Stallburschen schrien herum. Veterinäre untersuchten die Pferde, ehe sie von den Requisitionsoffizieren übernommen wurden. In der Schicksalsstunde, in der Millionen von Menschen der Tod bevorstand, in der Verbrecher auf den Thronen Deutschlands und Österreich-Ungarns, die sie auf Grund des sogenannten Gottesgnadentums innehatten, ihre Truppen wie zur Schlachtbank geführte Herden vor sich defilieren sahen, war ich von brennender Empörung und moralischer Entrüstung erfüllt, die die Sorge um die unsichere Zukunft meiner Familie und meines Schaffens bei weitem überschatteten. Ich fühlte mich mit unheimlicher Gewalt dorthin gezogen, wo die Kämpfe tobten. Ich war zu allem, zum unmöglichsten bereit: das Blutbad aufzuhalten und die unschuldigen Opfer vor dem Tod zu bewahren. Dann schlug die Erregung in tiefste Niedergeschlagenheit um. Ich schauderte vor dem Gefühl völliger Verlassenheit, vor apokalyptischen Visionen, vor der Gefahr des Wahnsinns. Die Wirklichkeit sah anders aus. Sie erschien mir in der Gestalt meines Freundes, des Geheimrats Professor Binswanger, des Psychiaters der Universität Jena. Er nahm mich in seine Privatklinik auf, wo ich bleiben sollte, bis er selbst und meine Jenaer Freunde sich einigermaßen über meine Zukunft klargeworden waren. Man fürchtete Maßnahmen des Großherzogs, dessen brutaler, jähzorniger Charakter ihnen nur zu bekannt war. Die Gelegenheit war für ihn nur zu günstig, sich für die stolze Gleichgültigkeit und die Herausforderung zu rächen, mit der ich nach seinem Wortbruch die mir von ihm übertragene Aufgabe weitererfüllte, ohne seine erlauchte Person zu beachten und ohne auf die Demütigungen zu reagieren, mit denen er meine Halsstarrigkeit zu brechen versuchte. Es war bekannt, daß Geheimrat Binswanger als einziger in der Lage war, den Großherzog an die Dienste zu erinnern, die ich ihm und Deutschland geleistet hatte. Wilhelm Ernst war schon als Kind wegen einer krankhaften jähzornigen Veranlagung von Binswanger in seiner Klinik behandelt worden und stand stets unter der Betreuung des berühmten Psychiaters. Die Blicke meiner Freunde und Schüler waren auf den Großherzog gerichtet, der mir nur die Pässe hätte auszuhändigen lassen brauchen, damit ich mich mit meiner Familie nach der Schweiz, nach Holland oder einem anderen neutralen Land hätte begeben können. Andere Fürsten und Regie- | |
[pagina 376]
| |
rungen, in deren Diensten Ausländer standen, hatten dafür das Beispiel gegeben. Am Tage nach meinem Eintritt in die Klinik setzte sich Professor Binswanger in meiner Gegenwart von seinem Arbeitszimmer aus mit dem Großherzog in Verbindung. Es stand ihm eine direkte Leitung zum Weimarer Palais zur Verfügung, ohne daß er ein Telephonamt in Anspruch nehmen mußte. Ich saß zur Seite des Geheimrats, der mir einen zweiten Telephonhörer reichte. So konnte ich seine Erklärungen über meinen Fall und seine Vorschläge mithören. Während der langen Ausführungen Professor Binswangers blieb der Großherzog zunächst stumm. Plötzlich stieß er die Worte aus, die für mich wie der Klang einer Totenglocke tönten: ‘Was, Sie sagen, Herr Geheimrat, van de Velde ist noch auf freiem Fuß? Den Kerl soll man einsperren!’ Am nächsten Morgen erklärte mich Professor Binswanger bei der üblichen Visite als seinen Patienten. Damit Übernahm er die Verantwortung für meine Person. Er setzte sich mit einigen seiner Kollegen an der Universität Jena in Verbindung, die ihm als meine Freunde bekannt waren: mit Ernst Haeckel, dem Biologen, mit dem ich durch Heirat verwandt war, mit dem Kunsthistoriker Botho Graef, dem Philosophen Rudolf Eucken, dem Juristen Rosenthal und mit Professor Czapski, der nach dem Tod des mit ihm befreundeten Ernst Abbe Direktionsmitglied der Zeiss-Werke geworden war. Gemeinsam beschloß dieses Gremium, das Geheimrat Binswanger über den Wutanfall des Großherzogs gegen mich orientiert hatte, bei Staatsminister Rothe für mich zu intervenieren, damit ein Gesetz auf mich angewendet würde, demzufolge jedem in Deutschland staatlich angestellten Ausländer die deutsche ‘Staatsangehörigkeit’ verliehen wurde. Diese ‘Staatsangehörigkeit’ bedeutete nicht den Verlust der ursprünglichen Nationalität. Meine Freunde handelten, ohne mich zu konsultieren. Sie wollten mich nur vor der Drohung des Großherzogs, mich internieren zu lassen, und gegen die Schikanen der Kommandantur in Kassel schützen. Nach einigen Tagen erhielt ich den Paß, der mit den Insignien des Deutschen Reiches versehen war und zugleich meine belgische Nationalität anerkannte. Während des Krieges und sogar bis zu dem Augenblick, als ich mich auf unbestimmte Dauer in Holland niederließ, hatte ich keinen anderen Paß. Erst von Holland aus konnte ich mich an das Außenministerium | |
[pagina 377]
| |
in Brüssel wenden, um einen neuen belgischen Paß zu beantragen. Professor Binswanger ließ mich durch einen Krankenpfleger in das Sanatorium seines Freundes Dr. Kohnstamm nach Königstein im Taunus bringen. Er orientierte meine Frau und stellte sich ihr zur Verfügung für den Fall, daß ihre oder die Sicherheit unserer Kinder bedroht würde. Mehrere Wochen war ich von den Meinen getrennt. In der Zurückgezogenheit des Sanatoriums begegnete ich im Park nur Nervenkranken in Begleitung des Pflegepersonals. Für sie war ich Herr X., ein Holländer. Dr. Kohnstamm verstand es, mich von meinen trüben Gedanken zu befreien und mich an meine Pflicht zu erinnern, die ich trotz der Katastrophe, welche meine Mission und mein Schaffen gleichsam entwurzelte, auch in Zukunft zu erfüllen hatte. Die Ereignisse hatten aus mir einen überzeugten Pazifisten gemacht, einen enttäuschten Revolutionär, der sich über den gescheiterten Aufstand der Massen klargeworden war. Unterdessen erhielt meine Frau pöbelhafte Briefe anonymer ‘patriotischer’ Fanatiker, die sie und meine Kinder mit dem Tode bedrohten. In diesen Wochen konnte ich nur auf Hugo Westberg zählen, der mir unerschütterlich die Treue hielt. Nach meiner Rückkehr ging ich täglich mit ihm zusammen in die verlassene Schule, denn ich blieb für das Gebäude und alles, was die Schule betraf, verantwortlich, solange mein Entlassungsgesuch nicht angenommen war. Unsere Gespräche, bei denen wir uns über die Zukunft klarzuwerden versuchten, wurden manchmal von Besuchen früherer Schüler unterbrochen, die Abschied nahmen, ehe sie an die Front gingen. Von diesen Schülern ist nur ein einziger aus den Schützengräben der Isère zurückgekehrt. Als ich endlich erfuhr, daß der Großherzog meine Demission angenommen hatte, wurde gleichzeitig von mir verlangt, daß ich mich täglich dreimal - morgens, mittags und abends - bei der Polizei meldete. Dreieinhalb Kilometer Weg von meinem Haus ‘Hohe Pappeln’, die ich zu Fuß zurücklegen mußte, da wegen des Krieges keine Transportmittel zur Verfügung standen! Diese Verpflichtung hinderte mich, irgend etwas anderes zu tun, als den ganzen Tag die Belvedere-Allee hinunter- und hinaufzugehen. Der sympathische Bürgermeister der Gemeinde Ehringsdorf, auf deren Boden sich unser Haus befand, bot sich an, meine Situation dadurch zu | |
[pagina 378]
| |
erleichtern, daß er meine Anwesenheit zu Hause selbst kontrollierte. Meine Freunde, die meine vor dem Krieg bestehenden Beziehungen zu hohen Beamten und mächtigen Persönlichkeiten in Berlin besser kannten als die städtischen Behörden in Weimar und die Kommandantur in Kassel, drängten mich immer wieder, mich an diese Kreise zu wenden, um eine großzügigere Auslegung der Ausnahmebestimmungen im Kriege zu erreichen. | |
Der Tod Alfred Walter HeymelsGegen solche Schritte weigerte ich mich hartnäckig bis zu dem Augenblick, als eine dieser Persönlichkeiten, der Staatssekretär im Kolonialamt Dr. Solf, mich nach Berlin zu meinem todkranken Freund Alfred Walter Heymel rufen ließ, der nach den ersten Tagen des Einmarschs in Belgien mit seiner Husareneskadron über Charleroi und Sedan auf Paris vorgerückt war. Der schwer lungenleidende Heymel war vom Pferd gestürzt und nach Berlin zurückgebracht worden. Heymel war mit seinem Vetter Rudolf Alexander Schröder zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Bremen nach München gegangen und zu jener Gruppe moderner Schriftsteller gestoßen, der auch Otto Julius Bierbaum und Frank Wedekind angehörten. Heymels Herkunft galt damals als Geheimnis. Bei seiner Volljährigkeit verfügte er über ein Vermögen von mehreren Millionen. In früher Jugend war er der Familie Schröder anvertraut worden, die ihn gemeinsam mit Rudolf Alexander erziehen ließ. In München waren die beiden jungen Männer unzertrennlich. Den Münchner Schriftstellern ermöglichte Heymel die Herausgabe der Zeitschrift, mit der sie sich bekannt machen sollten. Dr. Solf hatte sich mit der Bitte, Heymel zu pflegen, an mich gewandt, weil alle seine Freunde - die auch die meinen waren - eingezogen waren. Von den Quälereien des Großherzogs und der Feindseligkeit eines Teils der Weimarer Bevölkerung gegen mich und meine Familie wußte er nichts. Er wollte mich während meines Aufenthalts in Berlin den möglichen Schikanen der Kommandantur in Kassel entziehen, mich, der ich ein ‘Gefangener in Freiheit’ war. Für die Bewilligung meiner Reise nach Berlin war | |
[pagina 379]
| |
die persönliche Intervention des Staatssekretärs beim Weimarer Staatsminister erforderlich. Ich kam also als Krankenwärter, der die christliche Nächstenliebe ernst nahm, in Heymels Berliner Wohnung in der Hohenzollernstraße. Solf wußte nichts von meinen pazifistischen Gefühlen und Überzeugungen; er hatte keine Ahnung, in welchem Maße ich mich während der Tage und Nächte der Besinnung im Königsteiner Sanatorium dem Pazifismus verschrieben hatte. Nach meiner Ankunft in Berlin besuchte ich zuerst Dr. Solf, um ihm für sein Vertrauen zu danken. Dann trat ich mein ungewohntes Amt als Krankenwärter an. Alfred Walter Heymel war nur noch der Schatten jenes Mannes, den ich einige Monate vor Kriegsbeginn gesehen hatte. Damals sah er kräftig aus, aber die Stimme klang schon verschleierter als sonst, und Hustenanfälle verrieten das Fortschreiten der Krankheit. Ein monatelanger Aufenthalt im Hochgebirge hätte vielleicht noch Heilung bringen können. Aber die Strapazen, die Heymel in den ersten Kriegswochen durchmachen mußte, beschleunigten das tödliche Leiden. Alfred Walter Heymel lag auf einem großen Bett. er reichte mir feierlich und langsam die Hand. Plötzlich wurde er von einem Anfall geschüttelt, dem ein Blutsturz folgte. Es gelang mir gerade noch, ihn zu stützen. Es war die erste Hilfeleistung, mit der ich meine Funktion begann. In einem kleinen Raum nebenan wurde ein Feldbett für mich aufgestellt. Von der Haushälterin erfuhr ich, daß ein alter Diener, der die Gewohnheiten Heymels kannte, engagiert worden war. Zum Abendessen wurde der Kranke ins Speisezimmer gebracht, und der Diener servierte das Mahl mit demselben Zeremoniell wie in früheren Zeiten. Heymel begann von seinen Kriegserlebnissen zu erzählen. Seine Augen leuchteten auf, um gleich darauf zu erlöschen; er sank zurück, und sein Kopf fiel nach vorn. Ehe wir ihn wieder zu Bett brachten, umarmte er mich und dankte für mein Kommen, für den Beweis der Freundschaft, auf die wir im Verlauf der Mahlzeit angestoßen hatten. Ich setzte mich an sein Bett und betrachtete den Schlafenden. Und vor dem bedauernswerten Wesen ließ ich den Verwünschungen gegen Krieg und Kriegsgesinnung freien Lauf. Aber im selben Augenblick empfand ich unaussprechliches Mitleid mit diesem Opfer, diesem Deutschen, meinem | |
[pagina 380]
| |
Freund, der die Verantwortung für eine Tat mittragen mußte, die ein Geistesgestörter im Namen einer Nation begangen hatte, die er ebenso als von Gottes Gnaden ansah wie sich selbst. Alfred Walter Heymel schwand langsam dahin. Wenige Tage vor seinem Tode waren Julius Meier-Graefe, der sich auf der Reise nach dem Osten einige Zeit in Berlin aufhielt, und ich Zeugen einer makabren Szene, die sich meiner Erinnerung tief eingeprägt hat. Wir hatten das Krankenzimmer verlassen, waren zum Nachtessen in Heymels Arbeitszimmer gegangen und saßen beim Kaffee, dem Meier-Graefe und ich ausgiebig zusprachen. Unterdessen hatte der alte Diener auf Heymels Bitte ihm die Uniform angezogen. Der Sterbende hatte wohl die Absicht, in diesem Aufzug uns die Geschichte seines Rittes auf Paris zu erzählen. An seinem Waffenrock war das Eiserne Kreuz befestigt. Welches Wunder an Starrsinn, welche übermenschliche Anstrengung hatten es bewirkt, vor uns dieses gespenstische Schauspiel erscheinen zu lassen? Heymel blieb auf der ersten Stufe einer kleinen Treppe stehen. Wir stürzten auf ihn zu. Er öffnete den Mund, konnte aber nur ein paar unartikulierte Laute von sich geben und fiel in unsere Arme. Wir legten ihn in voller Uniform, den Helm auf seinem Kopf, auf sein Bett, wo er uns wie ein Ritter aus Erz auf einem Sarkophag in einer mittelalterlichen Kirche erschien. In den nächsten Tagen verschlimmerte sich sein Zustand. Ich erzählte ihm von Charleroi, von Paris, aber er erinnerte sich nicht mehr. Es machte ihm Freude, mich vorlesen zu hören, aber er konnte die Sätze nicht mehr auffassen. So sah ich ihn langsam sterben, und an einem Morgen bemerkte ich, daß er das Bewußtsein verlor. Mir entglitt das Buch, das ich in Händen hielt: Baudelaires ‘Fleurs du mal’. Es dauerte eine Stunde, die mir wie eine Ewigkeit erschien. In meinen Armen hauchte er sein Leben aus. | |
[pagina 381]
| |
Während des Krieges in WeimarZwei Tage später befand ich mich wieder in Weimar. Als Dora von Bodenhausen gehört hatte, daß unsere Kinder sich vermeintlich in Gefahr befanden, kam sie nach Weimar und nahm die beiden jüngsten mit nach Degenershausen im Harz, wo sich das Gut der Bodenhausens befand. Von den anderen Töchtern war die eine in Jena bei Professor Czapski, die andere in Oberbayern in Hinteröhr bei Ottonie von Degenfeld untergebracht. Nele, die älteste, war noch in Rußland, von wo sie erst im Herbst 1915 über Schweden zu uns zurückkehren konnte. So waren meine Frau und ich allein in unserem Haus; das Familienleben war gestört. Wir beschlossen, im Haus ‘Hohe Pappeln’ zu bleiben, solange unser Diener nicht zum Militär einrücken mußte und das materielle Leben einigermaßen normal bleiben würde. Die polizeilichen Maßnahmen blieben die gleichen. So lebte ich - allerdings unter Ehrenwort - im Zustand einer gewissen Freiheit, nachdem endlich die tägliche Meldepflicht, die am lästigsten war, aufgehoben wurde. Ich beschloß, zwei Bücher zu schreiben, deren eines die Ideen zusammenfassen sollte, die ich in meinen beiden Büchern ‘Der Neue Stil’ und ‘Essays’ veröffentlicht hatte, und deren zweites als grundlegendes Werk über ‘Die Linie und das abstrakt-lineare Ornament von der Prähistorie bis heute’ gedacht war. Während das zweite nie erschien und vielleicht nie erscheinen wird, wurde das erste unter dem Titel ‘Les Formules de la Beauté architectonique moderne’ in französischer Sprache mitten im Krieg damals in Weimar gedruckt. Harry Kessler hatte mich von der russischen Front aus, wo er zwei Jahre lang stand, gebeten, mich der zwei Arbeiter anzunehmen, die für ihn auf einer Handpresse, die er ‘Cranach-Presse’ getauft hatte, in den Jahren vor 1914 typographische Meisterwerke gedruckt hatten. Diesen beiden tüchtigen Männern, die keine Ahnung von der französischen Sprache hatten, übergab ich den Text der ‘Formules’, und sie druckten ihn im Laufe des Winters 1916 auf 1917. Die Korrektur der Druckfahnen dieser neunzig großformatigen Seiten bereitete mir keine geringe Mühe! Dieser Weimarer Druck kam nicht in den Handel. Das Buch selbst erschien erst 1923 in Brüssel. In dem Buch über die Linie verfolgte ich meine Studien und neuen Ent- | |
[pagina 382]
| |
deckungen über die Natur der Linie und des abstrakt-organischen Ornamentes weiter. Auf diesem Gebiet arbeiteten der Münchner Ästhetiker Theodor Lipps und ich parallel, ohne daß der geringste Kontakt zwischen uns bestand. Ich hatte vor ihm eine Definition gefunden, die von zahlreichen Theoretikern, Architekten und Künstlern diskutiert und akzeptiert wurde. Sie stammt aus dem Jahr 1901 und lautet: ‘Die Linie ist eine Kraft.’ In einem Artikel in der ‘Zukunft’ (September 1902) habe ich sie selbst kommentiert. Um meine Studien weiterzutreiben, unternahm ich jetzt Reisen nach Berlin, München und anderen Städten, deren öffentliche Bibliotheken ich zu Rate zog. Dr. Solf, immer zu meiner Unterstützung bereit, half mir, die Reisebewilligungen zu erhalten. Im Dezember 1914 erhielt ich einen Brief eines meiner deutschen Freunde, Erhard von Mutius, mit der Mitteilung, daß man mich von den Schwierigkeiten befreien wollte, die mir militärische Behörden bereiteten. Mutius war ein Neffe des deutschen Reichskanzlers von Bethmann-Hollweg; er war über die Schritte orientiert, die höheren Ortes für mich unternommen worden waren. Nachdem ich mich ehrenwörtlich verpflichtet hatte, ‘nichts zu sagen und zu tun, was für Deutschland schädlich sein könnte’, wurden mir unbehinderte Reisen in Deutschland bewilligt. Täglich ging ich für ein paar Stunden in die Kunstgewerbeschule, wo noch einige junge Leute in den Werkstätten arbeiteten. Nach Möglichkeit ersetzte ich die zum Militär eingerückten Lehrer, aber nach und nach leerten sich die Ateliers. Trotzdem durfte ich die Schule nicht schließen. Das wurde erst möglich, als mein Vertrag ablief, den ich nachgerade als eine Tortur empfand: am 15. Juli 1915 wurde die Schule geschlossen, ein Ereignis, das mich stark bewegte. Der Winter 1916/17 - er war außergewöhnlich hart, das Thermometer sank bis auf 27 Grad unter Null - brachte der ganzen deutschen Bevölkerung eine wahre Hungersnot. Abgesehen von den beiden Dienstboten, die die Küche nicht mehr verließen, lebten wir, Eltern und Kinder, in einem einzigen, von einem kleinen Ofen geheizten Zimmer. Die Eltern verzichteten auf ausreichende Ernährung zugunsten der Kinder, die Hunger litten. Ab und zu gewährte uns der Bürgermeister von Ehringsdorf, der, obwohl er ein einfacher Mann war, meine tragische Lage verstand, eine erhöhte Brotration. | |
[pagina 383]
| |
Das Ende der Deutschen PeriodeIm Frühjahr 1917 erschien eine Verordnung, die jeden deutschen Staatsangehörigen von siebzehn bis sechzig Jahren zum obligatorischen Zivilhilfsdienst verpflichtete. Die Empfänger dieser Verordnung wurden aufgefordert, anzugeben, welche Dienste sie leisten konnten. Eine solche Aufforderung wurde auch mir zugestellt. Sie bedeutete eine Gefahr, die meine an sich schon delikate und paradoxe Lage noch mehr zu komplizieren drohte. Die Dienste, die ich für Deutschland unter Umständen zu leisten hätte, konnten sich für mein belgisches Vaterland nachteilig auswirken, zumindest konnten sie dazu führen, daß ich einer falschen Beurteilung von seiten meiner Landsleute ausgesetzt würde. Ich hatte um so mehr Grund, diese Möglichkeit zu befürchten, als - wie ich vernahm - deutsche Freunde glaubten, mir dadurch einen Dienst zu erweisen, daß sie mir durch das Generalgouvernement in Brüssel die Direktion der Antwerpener Akademie anbieten ließen. Diese Freunde hatten offenbar etwas von der bevorstehenden Hilfsdienstpflicht geahnt und wollten die Kommandantur und die Weimarer Behörden vor vollendete Tatsachen stellen. Aber die Verwirklichung eines solchen Schrittes hätte mir nur geschadet. In dieser Situation fuhr ich nach Berlin, um Dr. Solf zu sprechen. Solf war ein radikaler Gegner des von Admiral Tirpitz verfochtenen uneingeschränkten Unterseebootkrieges. Andrerseits war er wie alle meine deutschen Freunde überzeugt, daß Deutschland den Krieg gewinnen werde und daß sich dann für mich eine wichtigere und ehrenvollere Aufgabe finden würde als die, die ich in Weimar innehatte. Er sagte mir seine Hilfe zu, wenn ich mich zu einer Übersiedlung nach den Vereinigten Staaten bereit erklärte, von wo ich seiner Meinung nach allerdings nicht vor Ende des Krieges zurückkehren konnte. Solf rechnete mit einem bevorstehenden Kriegseintritt Amerikas und mit einer langen Dauer des Krieges. Nicht wissen konnte er freilich, daß mein innerer Bruch mit Deutschland endgültig und unwiderruflich war. Solf wandte sich dann an den Generaldirektor der preußischen Museen, Wilhelm von Bode, dem ich kein Unbekannter war. Bode fand rasch eine Lösung, der auch der übertriebenste ‘Patriot’ nicht vorwerfen konnte, sie schade meiner belgischen Heimat oder meiner Ehre. Er beauftragte mich, | |
[pagina 384]
| |
Untersuchungen über die Lage der in der Schweiz internierten deutschen Architekten, Maler, Bildhauer und Kunstgewerbler durchzuführen und Vorschläge für die Verbesserung ihrer Situation zu machen. Ich entschloß mich, zunächst allein abzureisen, um den Meinen einen Unterschlupf in der Schweiz zu suchen. Ein teuflischer Zufall wollte es, daß der Großherzog nach Weimar kam, kurz nachdem ich Deutschland den Rücken gekehrt hatte. Sofort ließ er von seinen Kriminalbeamten eine Durchsuchung unseres Hauses ‘Hohe Pappeln’ vornehmen. Die Pässe meiner Frau und der Kinder wurden im Schreibtisch Marias entdeckt und die Ausreise verhindert. Alle Schritte, die ich unternahm, waren vergebens, und auch meine Freunde konnten angesichts der außerordentlichen Spannung zwischen den militärischen und zivilen Behörden die Ausreisebewilligung für meine Familie nicht erwirken. Meine Frau wandte sich an Professor Binswanger, der ihr riet, zu warten. Sie wartete bis zum Ende der Feindseligkeiten. Ich selbst fühlte mich in der Schweiz, wohin ich gegangen war, zunächst nicht weniger niedergeschlagen und isoliert als in Weimar. |
|

