Geschichte meines Lebens
(1962)–Henry Van de Velde–
[pagina 273]
| |
Zehntes Kapitel
| |
Die Künstlerbund-Ausstellung in London 1906Die Beziehungen zwischen Deutschland und England befanden sich 1906 im Zustand einer gefährlichen Spannung. Graf Kessler, dessen offiziöse Beziehungen zur ‘Wilhelmstraße’, das heißt zum Auswärtigen Amt des Deutschen Reiches, nicht unbekannt waren, widmete sich mit höchster Intensität dem Versuch, die drei Nationen Deutschland, England und Frankreich, die einem verhängnisvollen Konflikt zusteuerten, kulturell einander zu nähern. In allen drei Ländern war man bereit, in Harry Kessler den Mann zu sehen, | |
[pagina 274]
| |
der über das Maximum an Autorität verfügte, die es ermöglichte, englische und deutsche Künstler zusammenzuführen und durch seine Beziehungen zu französischen künstlerischen Kreisen zu einem geistigen und menschlichen Austausch zu gelangen. Seit unserer Übersiedlung nach Weimar waren Harry und ich ja die eifrigsten und begeistertsten Vermittler der modernen französischen Malerei und Bildhauerei gewesen, und auch mit englischen Künstlerkreisen hatten wir die Verbindung aufgenommen. Auf einem vom Lyzeumklub in London veranstalteten Bankett hatte der englische Porträtmaler Sir John Lavery den Plan einer deutschen Kunstausstellung angekündigt, der auf die Initiative des Grafen Kessler zurückging. Kurz darauf erfolgte die offizielle Einladung von seiten der Gruppe unabhängiger englischer Künstler an den ‘Deutschen Künstlerbund’. ‘Ich bin glücklich’, schrieb mir Harry am 21. Januar 1906, ‘beiden Aufgaben dienen zu können, die mir am meisten am Herzen liegen: der Kunst und dem Frieden.’ Die einladende englische Künstlergruppe setzte sich direkt mit mir in Verbindung und übertrug mir die Einrichtung dieser Ausstellung in der ‘Princess Gallery’ in South Kensington, in der sich zeitweise eine Kunsteisbahn befand. Die weiten Räume hatten früher schon einmal einer Ausstellung der ‘International Society of Art’ gedient, die Whistler organisiert hatte. Ich war glücklich und fühlte mich geehrt, meinen Weimarer Kunsthandwerkern die Einrichtungsarbeiten anvertrauen zu können, die die Umwandlung der ‘Princess Gallery’ in Ausstellungsräume erforderte. Der Eröffnungstermin war auf den 1. Mai 1906 festgesetzt; ich hatte für die Entwürfe und Vorarbeiten drei Monate Zeit. Für die Montage und die Ausführung der dekorativen Details brachte ich meine Arbeitsgruppe von Weimar nach London mit. In Weimar selbst waren sämtliche Arbeiter und Ziseleure der Müllerschen Werkstätten damit beschäftigt, die Metallarbeiten fertigzustellen, die für die mir zur Verfügung gestellten Vitrinen bestimmt waren. Die Ausstellung in London enthielt nämlich neben der bildenden Kunst auch eine kunstgewerbliche Abteilung, deren Zusammenstellung Harry Kessler übertragen worden war. Ich hatte im Dezember 1905 in der Galerie Druet in Paris eine Kollektion von Silberarbeiten ausgestellt. Sie kamen zwar rechtzeitig nach Weimar zurück, aber ich konnte sie für die Ausstellung in der ‘Princess Gallery’ | |
[pagina 275]
| |
nicht verwenden, weil die englischen Zollvorschriften die Einfuhr von Silberarbeiten unter einem bestimmten Silbergehalt nicht gestatteten. Über die Ausstellung bei Druet, mit der zum ersten Male seit 1896 wieder Arbeiten von mir in der Pariser Öffentlichkeit erschienen, schrieb der ‘Figaro’ im Dezember 1905: ‘Henry van de Velde stellt eine Reihe von einzigartigen Silberarbeiten aus. Da wir Dezember schreiben, ist es eine Art Weihnachtsausstellung. Aber sie bedeutet mehr: sie läßt den Willen zur Logik erkennen, zur Einfachheit und Harmonie, der alle Werke dieses Erneuerers der dekorativen Kunst belebt. In jedem der ausgestellten Objekte wirken sich organische Linien aus, die sich gegenseitig bedingen, sich beeinflussen, die sich zusammenschließen und die Volumen wie die Oberflächen bestimmen. Die Ornamente erscheinen als Kristallisation des Spiels von Licht und Schatten, wie Akzente, wie der Grundton eines Verses oder Reimes. Und auch das kleinste Stück wirkt durch den Ausdruck seiner Umrisse, durch die Natürlichkeit, mit der sie in der Hand dessen liegen, der sie berührt, und durch die Selbstverständlichkeit, mit der es sich mit anderen zu einer Gruppe zusammenschließt. Teeservice, Silberplatten, Besteck, Samowar, Hummergabeln, Gemüseschüsseln, Tischleuchter und so weiter - fünfzig kostbare Objekte, jedes aus einem Stück, ohne Verlötungen. Die Ausführung von Hans und Wilhelm Müller, den Hofjuwelieren von Sachsen-Weimar, wohin van de Velde vom Großherzog berufen worden ist, zeigt ein Können von einzigartiger Feinheit und Sensibilität; meisterhaft in der Hammerarbeit wie in der Ziselierung, in denen sich das Materialgefühl des Entwerfers wie des Ausführenden offenbart. Maître Henry van de Velde hat vielleicht den Stil, dessen Schöpfer er ist, schon in größerem Rahmen angewendet, aber, wie uns scheint, nie vollendeter, nie rhythmischer, nie geläuterter.’
Die Londoner Ausstellung war die erste von modernem Geist inspirierte Veranstaltung im Ausland, durch die sich Publikum und Kritik ein Bild des Schaffens der deutschen Maler und Bildhauer machen konnten, die am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts neue Wege der Kunst beschritten. Ein peinlicher Umstand drohte, die Eröffnung der Londoner Ausstellung unmöglich zu machen. Ich hatte für den Boden der Kunsteisbahn Kokosmatten bestellt. Die Firma, welche die Matten in dem von mir be- | |
[pagina 276]
| |
stimmten amarantroten Ton zu färben hatte, ging zu spät an die Arbeit. Meine Befürchtungen bestätigten sich am frühen Morgen der Ausstellungseröffnung: die am Abend vorher aufgetragene Farbe war noch naß und glänzend wie Asphalt auf der Straße nach einem Platzregen. Ich war verzweifelt und ratlos. Plötzlich kam mir ein Gedanke. Auf dem Weg zur ‘Princess Gallery’ hatte ich vor einem großen Dampfsägewerk Riesenhaufen von Sägespänen liegen sehen. Der Lieferant der Matten wurde alarmiert, ich beschimpfte ihn in Französisch mit den fürchterlichsten Ausdrücken, die mir die Wut eingab - ich, der ich sonst nie in Zorn geriet -, und schrie: ‘Ich brauche sofort Lastwagen und Männer, die Sägespäne herbeischaffen, sie über die ganzen Matten streuen und mit dem Rechen bearbeiten wie in einer Zirkusarena!’ Die Eröffnung fand zur festgesetzten Stunde statt. Die ungewohnte Verwendung von Sägespänen wirkte als origineller und glücklicher Einfall. Ich nahm die Glückwünsche um so heiterer entgegen, als die Wirkung wirklich ausgezeichnet war. Beim Bankett am gleichen Abend hatte ich das Vergnügen, neben anderen Persönlichkeiten May Morris, William Morris' Tochter, Walter Crane und Bernard Shaw kennenzulernen. Ich saß am Ehrentisch neben May Morris. Crane und Shaw saßen uns gegenüber. Crane brachte in Englisch einen Trinkspruch auf mich aus. Ich antwortete in Französisch zur Verwunderung der Anwesenden, von denen die wenigsten wußten, daß ich Belgier war. Bernard Shaw war beauftragt worden, der englischen Regierung zu danken, die durch den Kriegsminister Lord Haldane vertreten war, der dem Bankett präsidierte. Man kann sich vorstellen, daß dieser scheinbar paradoxe Umstand dem bissigen Spötter Anlaß zu allerhand Sarkasmen gab. Und dies, obwohl Shaw genau wußte, daß der Kriegsminister als ausgezeichneter Kunstkenner besser als irgend jemand für diese Rolle geeignet war, auf jeden Fall besser als der Fachminister, dem die Kunstverwaltung zugeordnet war. Bernard Shaw hatte leichtes Spiel. ER hielt eine glänzende und besonders geistreiche Ansprache. Für den nächsten Tag waren alle in London anwesenden deutschen Künstler zu einem großen Bankett eingeladen, das der Lord-Mayor Londons im Mansion-House gab. Es war eine prunkvolle Veranstaltung nach altem Glanz und Brauch, bei der man sich in mittelalterliche Zeiten zurückversetzt fühlte. | |
[pagina 277]
| |
In der ‘Tribune’ erschien folgende Besprechung der Deutschen Kunstausstellung: ‘Eine große Menschenmenge mit stark kosmopolitischen Einschlag fand sich gestern in der ‘Princess Gallery’, Knightsbridge, zusammen, als Prinzessin Christiane in Begleitung des Prinzen die Deutsche Kunstausstellung feierlich eröffnete. Mr. Lavery hielt als Präsident des Vorstandes britischer Künstler, die die Ausstellung organisiert hatten, eine kurze, die Ziele der Ausstellung erklärende Ansprache. Walter Crane sprach der Prinzessin den Dank der Veranstalter aus. Er pries die Energie des Architekten, Professor van de Velde, unter dessen Leitung die Ausstellungsräume eingerichtet und ausgestattet wurden. Mr. Cranes Lob war wohlberechtigt. Besucher der Kunsteisbahn konnten kaum glauben, daß es sich um das gleiche Gebäude handelte, so vorzüglich haben Professor van de Velde und seine Helfer es in eine Reihe gut beleuchteter, einfach gestalteter Galerieräume verwandelt. Die Wände sind in blassem Rot gehalten, der Boden ist mit roten, mit Sägespänen bedeckten Matten belegt. Die Bilder hängen fast alle auf gleicher Höhe. Verglichen mit dem unruhigen Durcheinander unserer Akademieausstellungen, wirkt der schlichte gute Geschmack der deutschen Ausstellung erholend und gefällig. Was man von den Bildern auch halten mag, sicher ist, daß die modernen deutschen Künstler es besser verstehen, eine Kunstausstellung zu arrangieren, als die meisten unserer Künstlervereinigungen.’ | |
Polemik um die Dresdner Kunstgewerbe-Ausstellung 1906Im gleichen Jahr 1906 stand in Dresden die Eröffnung der Kunstgewerbe-Ausstellung bevor. Die Dresdner Ausstellung von 1897 war eine Überraschung gewesen. Diesmal galt es, einen Überblick über das Schaffen der Vertreter der neuen künstlerischen Auffassungen zu geben. Die Ausstellung von 1897 hatte mich plötzlich an die Spitze der neuen Bewegung getragen. Inzwischen war ich, obwohl Ausländer, zu einer entscheidenden Funktion in Deutschland gelangt. Kein Wunder, daß die Gegner unserer Bewegung die Dresdner Ausstellung zum Anlaß einer Auseinandersetzung zu machen gedachten, um ihre bedrohten Interessen zu verteidigen. Es sollte alles daran- | |
[pagina 278]
| |
gesetzt werden, daß der ‘neue Stil’ auf der Strecke blieb. Die bevorstehende Eröffnung der Ausstellung wurde von den uns günstig gesinnten Zeitungen und Zeitschriften als kommendes wichtiges Ereignis vorbesprochen. Aber auch unsere Gegner bezogen gute Positionen, um die Angriffe zurückzuschlagen, die wir unsrerseits auf sie vorbereiteten. In den Kolumnen der Zeitungen spielten sich die ersten Vorgefechte ab. Wir, die wir 1897 die erste Schlacht für die neue Kunst in Deutschland geschlagen hatten, mußten neun Jahre später noch einmal die Attacken über uns ergehen lassen, die von einer Meute feindlich gesinnter Künstler, Handwerker, Journalisten und Interessenverbände gegen uns geführt wurden. Die Vorahnung der Gefahr, die schon lange auf mir lastete, hatte mich nicht getäuscht. Die Dresdner Ausstellung, deren Eröffnung Ende Mai 1906 stattfand, war der Ort, an dem ich meine Stellung gegen meine Gegner aus den verschiedensten Lagern verteidigen mußte. Die Zahl der deutschen Künstler, die sich der neuen Bewegung angeschlossen hatten, war wesentlich größer geworden. Von vielen Seiten begann man, mir den Rang streitig zu machen, den ich mir in zehn Jahren des Kampfes erobert hatte. Nacheinander waren Richard Riemerschmid, Bernhard Pankok, Bruno Paul, August Endell, Josef Olbrich, Peter Behrens in die Arena gestiegen. Trotzdem mußte ich allein kämpfen, denn ich konnte nur mit wenigen ihrer Arbeiten, die sie bei der Ausstellung der Darmstädter Künstlerkolonie von 1901 oder der Weltausstellung von St. Louis 1904 gezeigt hatten, einverstanden sein. Ich mußte in Dresden nicht nur meine eigene Position verteidigen, sondern auch meine Weimarer Mitarbeiter, die Kunsthandwerker und Industriellen des Großherzogtums ins Feuer führen. Das Projekt für einen Museumsbau in Weimar schien damals Gestalt anzunehmen. Bei den Diskussionen über die Beteiligung Weimars an der Dresdner Ausstellung schlug ich vor, dort einen vollständig eingerichteten Museumssaal zu zeigen, dessen Wandgemälde Ludwig von Hofmann übertragen werden sollten. Ich dachte an einen Raum, der später dem geplanten neuen Weimarer Museum einverleibt werden konnte. Für Harry Kessler und mich bedeutete dieses Vorgehen zugleich eine willkommene Probe aufs Exempel. Die notwendigen Mittel für den Aufbau des Museumssaales in Dresden wurden von der Weimarer Regierung anstandslos bewilligt, und Ludwig von Hofmann erhielt den Auftrag für die großen Wandgemälde. | |
[pagina 279]
| |
1895 hatte Rodin bei der Eröffnung der Ausstellung bei Bing in Paris der Schar der Gäste auf offener Straße mit Stentorstimme zugerufen: ‘Dieser van de Velde ist ein Barbar!’ Mit der gleichen Begründung verlangte zehn Jahre später der hochangesehene Kritiker des ‘Berliner Tageblatts’, Fritz Stahl, in seinem Bericht über die Dresdner Ausstellung, meine Vertreibung aus Deutschland, wo ich - an der Spitze der eingedrungenen ‘Fremdlinge’ - seit Jahren eine große Zahl von Schülern gewonnen hätte. Und ein großer Teil der Presse stimmte seinem Verlangen zu. Andrerseits unterstützten mich Kritiker und Kunstschriftsteller vom Format eines Meier-Graefe, eines Hans Rosenhagen, Karl Scheffler und Johannes Schlaf und kleinere Geister, die mir ebenso wohlwollend, ja enthusiastisch gesinnt waren, weil sie wie ich an das Entstehen eines ‘neuen Stils’ glaubten. Der Kriegsruf, der dem Kampf gegen den ‘neuen Stil’ galt, ließ keinen Zweifel an dem weitgesteckten Ziel: mich, der ich zu einer radikalen Remedur gegen das Gift der offiziellen Kunst und Kunsterziehung aufrief, in Deutschland unmöglich zu machen. Der Kriegsruf lautete: ‘Barbaren über uns!’ Ein bisher unbekannter Kritiker, der junge Dr. Paul Fechter, ließ Fritz Stahl keine Zeit, die angekündigte Serie seiner Feuilletons über die Dresdner Ausstellung fortzusetzen. Er sprang mit einem Satz auf den Kampfplatz, nahm die Herausforderung an und schlug mit schärfsten Waffen zurück. ‘Philister über uns!’ - dies war der Titel von Fechters Entgegnung. Damit war eine Pressefehde ausgebrochen, in deren Verlauf Fechter den niederträchtigen Argumenten der Gegner eine sorgfältig überlegte Darstellung der Entwicklung des ‘neuen Stils’ bis zum Jahre 1906 gegenüberstellte. Der Museumssaal war nach Stahl, der sich im übrigen eines zurückhaltenden Tones befleißigte, die ‘größte Scheußlichkeit aller Scheußlichkeiten’. Demgegenüber schrieb Paul Fechter: ‘Wer nur einmal mit etwas Geduld versucht hat, den Intentionen dieser eigenwilligen Persönlichkeit nachzugehen, der wird, vorausgesetzt, daß er überhaupt zu verstehen vermag, zuletzt schon dahinterkommen, was van de Velde beabsichtigt hat, und er wird erkennen, wie dieser vielgeschmähte Raum einer der am feinsten, einheitlichsten und persönlichsten wirkenden von allen ist. Hier spricht ein Mensch, der letzte Persönlichkeitskultur besitzt, einer, der weiß, was er kann und vermag, und mit ruhi- | |
[pagina 280]
| |
ger Sicherheit sich auf sein Wollen verlassen darf. So abgebraucht das Wort ist, etwas im besten Sinn Aristokratisch-Vornehmes liegt über diesen Räumen, klingt in der sicheren, großen Linienführung, die mit feinstem, nervösem Empfinden den Fluß und das Ausklingen der Formen bekleidet.’ Neben dem vieldiskutierten und so verschieden beurteilten Museumssaal besprach Fechter ausführlich meinen persönlichen Beitrag zur Dresdner Ausstellung, zu dem mich die Ausstellungsleitung trotz meiner Eigenschaft als Ausländer eingeladen hatte: ein Musik- und ein Speisezimmer für den Intendanten des Wiesbadener Hoftheaters Curt von Mutzenbecher. Auf dem Tisch und dem Büfett mit Drehvitrinen befanden sich Silberarbeiten, Porzellan, Bestecke und Gläser; die Wände waren mit Tapeten nach meinem Entwurf ausgestattet. Welchen Gemeinheiten ich ausgesetzt war und gegen welche Beleidigungen mich Paul Fechter mit jugendlichem Schwung verteidigte, geht aus einem anonymen Beitrag in den ‘Münchner Neuesten Nachrichten’ hervor, der die Aufmerksamkeit des Kaisers ausgerechnet auf eine ‘offenkundige Insubordination’ des Wiesbadener Intendanten zu lenken suchte. Diese widerliche Niedertracht traf übrigens nicht allein das angegriffene Opfer, sondern wies alle diejenigen, die sich an mich wandten, um in einer Umgebung nach ihrem Geschmack zu leben, auf die Gefahr hin, sich damit dem Unwillen des Kaisers auszusetzen. Es hieß in den ‘Münchner Neuesten Nachrichten‘: ’Welch einen traurigen Eindruck muß es machen, wenn ein deutscher Theaterintendant, ein königlich-preußischer obendrein, heutigen Tages keinen anderen Architekten findet als den Belgier van de Velde, keinen anderen Maler als den Pariser Maurice Denis, keinen anderen Bildhauer als den Pariser Maillol. Das Wandbild von Denis ist wenigstens noch ganz geschmackvoll; aber diese ‘sitzende Büste’ von Maillol, deren Fleisch wie ein Haufen Pneumatikreifen wirkt, die taugt doch überhaupt nichts. Es ist viel darüber gemurrt worden, daß van de Velde hier überhaupt noch als Eindringling auftreten konnte. Gewiß, keine andere Nation gestattet solche Einmischungen in nationale Angelegenheiten. Aber in diesem Fall war unsre Weitherzigkeit vielleicht doch ganz gut. Indem wir den Import neben unseren Eigenbau stellten, erkannten wir unsere eigene Überlegenheit.’ Ein anderer Kritiker drückte sich in der ‘Welt am Montag’ nicht weni- | |
[pagina *41]
| |
 | |
[pagina *42]
| |
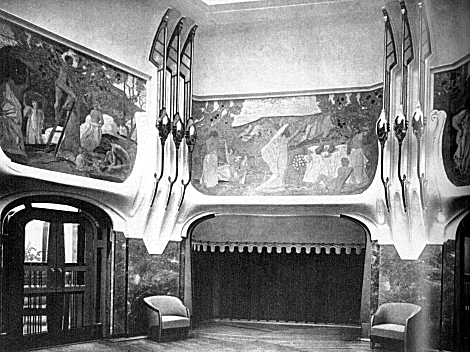
80 Museumshalle in der Kunstgewerbe-Ausstellung Dresden 1906
| |
[pagina *43]
| |
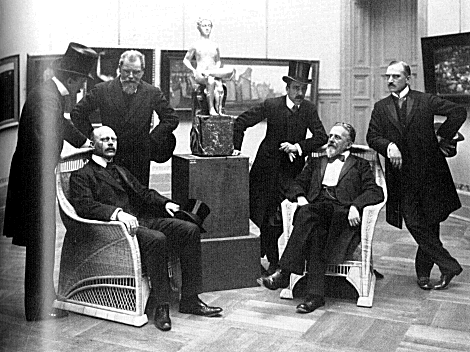
81 Ausstellungseröffnung in Weimar, von links nach rechts: Graf Kessler, Ludwig von Hofmann, Max Klinger, Henry van de Velde, Theodor Hagen, Hans Olde
| |
[pagina *44]
| |

82 Kunstschule in Weimar, 1904

83 Kunstgewerbeschule in Weimar, 1906/07, im oberen Stock die Ateliers van de Veldes
| |
[pagina 281]
| |
ger aggressiv über mich aus: ‘Er soll sich aus dem Staube machen, ehe er seinen Ruf als Reformator des Kunstgewerbes umgewandelt hat in den eines Destruktors, eines Zerstörers. Mag er seine schwülen Träume lieber in seiner belgischen Heimat als in unserem schlichten Weimar träumen. Weg mit ihm!’ Öffentlich als Feind Nummer Eins gebrandmarkt, befand ich mich in einer paradoxen Lage. Meine Gegner entnahmen ihre Munition meinem eigenen Arsenal und kehrten meine eigenen Waffen gegen mich. Sie verdrehten meine Prinzipien, warfen sich zu Richtern auf und gebärdeten sich päpstlicher als der Papst. Mitten in diesem Hin und Her zwischen Lob und Tadel wartete ich gespannt auf eine Äußerung Karl Schefflers, der schon um die Jahrhundertwende so warm für mich eingetreten war. Er schrieb über die Dresdner Museumshalle: ‘Van de Velde zeigt in dieser Ausstellung einen Museumsraum, der in allem einzelnen anfechtbar, aber doch die stärkste Talentäußerung ringsumher ist. In dieser Arbeit zeigt sich wieder der leidenschaftliche Drang zum Wachsen und Reifwerden, der die umstrittenen Werke dieses Künstlers so wertvoll macht. Im höchsten Maße interessant ist selbst das Nichtgeglückte: das Verhältnis von Stuckmasse und Paneel, von Stein und Holz und die Gewaltsamkeiten der Metallverwendung.’ Scheffler sprach sich weniger enthusiastisch aus als Paul Fechter und zögerte immer noch, mich als Architekten anzuerkennen. Als sich der durch die Pressefehde entfachte Aufruhr der ersten Wochen gelegt und ich einige Tage der Ruhe bei meinen Freunden, dem Prinzen und der Prinzessin zu Schwarzburg-Rudolstadt, verbracht hatte, bildete ich mir selbst ein Urteil. Was man auch dafür und dawider geschrieben hatte: die Museumshalle erschien mir als ein mißlungenes Werk. Sie war allzu flüchtig entworfen und ungenügend ausgeführt. Flüchtigkeit ist meinem Wesen fremd, und der Sorgfalt der Ausführung galt sonst stets mein Hauptbemühen. Die Presseangriffe anläßlich der Dresdner Ausstellung und immer wieder aufflammende Gerüchte über die Gefährdung der Stellungen von Ludwig von Hofmann, Harry Kessler und mir verursachten in Weimar große Unruhe. Meine Mitarbeiter bestürmten mich mit Fragen, und die von mir beschäftigten Kunsthandwerker und ihre Arbeiter sahen sich in ihrer Existenz bedroht. Erst als Harry aus dem Manöver zurückkam und in Weimar, | |
[pagina 282]
| |
betreut von seinem Diener, sein früheres Leben wiederaufnahm, wurde es wieder ruhiger. Volle Beruhigung trat aber erst ein, als bekannt wurde, daß ich an der Belvedere-Allee, halbwegs zwischen dem Großherzoglichen Schloß und Schloß Belvedere, Terrain gekauft hatte, um mir und meiner Familie ein Haus zu errichten. | |
‘Hohenhof’Ungefähr zur gleichen Zeit erfuhren meine Mitarbeiter, daß Karl Ernst Osthaus plante, sich in Hagen eine große Villa bauen zu lassen. Einige von ihnen waren in Hagen schon dabeigewesen, als die in Weimar hergestellten Möbel und Museumseinrichtungen im Folkwang-Museum eingebaut wurden. Osthaus hatte in ‘Hohenhagen’ einige Dutzend Hektar Land gekauft, konnte sich aber zunächst noch nicht über die Wahl des Architekten schlüssig werden, dem er die Pläne für den ‘Hohenhof’, sein bevorzugtestes Bauprojekt, anvertrauen wollte. Die Überlegungen, die Osthaus bewegten, mir den Auftrag zu geben, hat er später in seinem Buch über mich mitgeteilt: ‘Während sich die gesamte Kritik diesen Leistungen gegenüber (gemeint sind meine Beiträge für die Dresdner Kunstgewerbe-Ausstellung) ablehnend und teilweise gar feindlich verhielt, führten gerade sie den Verfasser aufs neue zu gemeinsamer Arbeit mit dem Künstler zusammen. Er plante den Bau eines größeren Wohnhauses und war mit der Absicht nach Dresden gefahren, den fähigsten Künstler auszuwählen, um auch diese Arbeit der neuen Bewegung so gut wie möglich dienstbar zu machen. Velde zum zweiten Mal heranzuziehen, lag keineswegs in seiner Absicht, da er ihn in Hagen genügend vertreten glaubte und seinen früheren Arbeiten im Museum keineswegs kritiklos gegenüberstand. Er hoffte vielmehr, durch die Wahl eines anderen Künstlers das Leben in seiner Heimat vielseitiger befruchten zu können. Die für ihn augenfällige Überlegenheit seiner Arbeiten und die fortgeschrittene Reife, die sich in ihnen kundgab, bestimmten ihn aber, alle Bedenken beiseite zu setzen und Velde den Bau zu übertragen.’ | |
[pagina 283]
| |
Das von Osthaus erworbene Terrain von zwanzig oder dreißig Hektar lag auf einem Plateau hoch über der Stadt und war vor den giftigen Rauchwolken der Fabrikschlote geschützt, die über Hagen lasten. Nichts verstellt den weiten Horizont. Ein seit langer Zeit stillgelegter Basaltsteinbruch, der in der Nähe liegt, konnte das im Ruhrgebiet traditionelle Baumaterial liefern. Auf diese Weise waren die Voraussetzungen für eine gewisse Einheitlichkeit der Villenkolonie gegeben, deren Realisierung Osthaus im Auge hatte. Als deren Bewohner rechnete er auf seine Freunde und andere westfälische Industrielle, die mit ihm zusammen im Rheinland und in Westfalen ein neues Zentrum geistiger und künstlerischer Aktivität ins Leben rufen wollten, das moderne Künstler, die sich bisher in Berlin, Dresden oder München niedergelassen hatten, nach Köln, Düsseldorf oder Hagen ziehen sollte. Der ‘Hohenhof’ wurde im Winter 1907/08 vollendet. Die beste Beschreibung des Hauses stammt von Osthaus selbst: ‘Es wird an dieser Schöpfung besonders deutlich, daß Velde bei der Gestaltung viel mehr von der Idee des plastisch zu modellierenden Körpers als von der Konkavität des Raumes ausgeht. Hierauf beruht seine Wahlverwandtschaft zu den Griechen, seine Abneigung gegen die Gestaltungen der Renaissance. Der Hohenhof zeigt das Bestreben, den Kubus als solchen zu greifen, besonders in der Abrundung der Obergeschoßecken an der Ostfassade, in der Ausbauchung des Badeerkers sowie in der Hochstelzung des Daches. Auch die Ausbildung der Schornsteine am Nebenhaus bestätigt das plastische Empfinden. Umgekehrt läßt keiner der Höfe und Gärten eine Neigung zur Raumformung erkennen. Die Belebung des Stoffes ist nicht in der atmenden Spannung zwischen Körper und Raum, sondern im dynamischen Ausdruck der Massen gesucht. Zum griechischen Kampf von Stütze und Last tritt aber das den Griechen unbekannte, den Gotikern um so geläufigere Motiv der Richtung, des drängenden Schubes. Da der Verfasser sich entschloß, auf seine bisherige Einrichtung zu verzichten, konnte der Hohenhof bis herunter auf das Petschaft auf dem Schreibtisch einheitlich durchgebildet werden. Er ist in dieser Beziehung eine der vollständigsten Schöpfungen des Künstlers geworden und bis zum heutigen Tage (1920) auch unberührt erhalten. Einige Kunstwerke von Bedeutung, so der ‘Auserwählte’ von Hodler, der ‘Spaziergang’ von Vuil- | |
[pagina 284]
| |
lard, ein Fliesentriptychon von Matisse boten Ausgangspunkte für die dekorative Gestaltung; für den Garten entwarf gleichzeitig Aristide Maillol eine ‘Sérénité’. Haller schmückte den Haupteingang mit Reliefs, Thorn Prikker entwarf später die farbige Treppenhausverglasung und das eingelassene Eulenbild im Herrenzimmer. Diesem Zusammenwirken lag ein starkes Gefühl für die Notwendigkeit einer Konvergenz des künstlerischen Schaffens beim Verfasser und beim Architekten zugrunde. In der Tat bestrebte sich dieser, die vorhandenen Kunstwerke formal und farbig so restlos in seine Raumkompositionen eingehen zu lassen, daß sie wie daraus hervorgewachsen erscheinen. Wand- und Möbelstoffe, Holzwerk, Teppiche und Vorhänge wurden nach ihnen abgestimmt, während umgekehrt weitere Kunstwerke nach den ornamentalen Bedürfnissen der Räume ausgewählt und eingestimmt wurden. Denn für ein Bild gilt dasselbe, was früher über das Ornament ausgeführt wurde: es hat nur insofern Berechtigung in einem Raume, als es diesen teilt und belebt, das heißt organisch mit ihm verschmilzt. Der Hohenhof ist als Dokument dieser Epoche um so bedeutsamer, als das gleichzeitige Eigenhaus des Künstlers in Weimar leider in den Tagen der Niederschrift dieser Arbeit (1920) seiner Auflösung entgegensieht.’ | |
Kesslers SturzDas Interesse für unsere Tätigkeit in Weimar stieg außerhalb der Grenzen des Großherzogtums ständig. Die Propaganda, die Harry Kessler in Paris und London machte, brachte uns Sympathien vieler Kunstfreunde und Kunstschriftsteller ein. In einem Brief vom Mai 1905 teilte er mir Einzelheiten darüber mit: ‘Persönlichkeiten, die ich gar nicht kenne, Druet, Denis-Cochin, Octave Mirbeau haben mir sagen lassen, daß sie mit uns Verbindungen aufzunehmen wünschen. Ich sehe, daß wir heute schon in England und Frankreich den gleichen starken Rückhalt besitzen wie in Deutschland. Wir halten die Welt der Kunst in unserer Hand. Um keinen Preis dürfen wir den wunderbaren Angelpunkt, den Weimar bedeutet, verlieren. Bei dieser Gelegenheit: Bonnard wird nach Weimar kommen...’ | |
[pagina 285]
| |
Aber in Weimar bereiteten sich finstere Dinge vor. Der Großherzog unternahm eine Reise nach Indien, die ihn mehrere Monate von Weimar fernhielt. Während dieser Zeit irrte der gleichsam arbeitslos gewordene Oberhofmarschall in den Räumen des Großherzoglichen Palais umher und suchte Stoff für eine Intrige, um sich ein für allemal von der Wahnvorstellung zu befreien, er werde verabschiedet. Ich hatte keinen Zweifel, was er anzettelte. Ich wußte, in welchem Maß er dem Grafen Kessler feindlich gesinnt war, und sah voraus, daß er ihm eine Falle zu stellen suchte, wie dies seine Art war, wenn er glaubte, irgend jemand dränge sich zwischen den Großherzog und ihn. Zunächst suchte er, die Beute, die er belauerte, unsicher zu machen und zu ermüden. Er lockte Harry mit Projekten, die Enttäuschungen bringen mußten, welche der Hofmarschall zynisch und skrupellos dem Großherzog oder der Regierung zuschob. In diesem Fall war es der Bau eines neuen Museums, für das die Mittel einerseits aus vorhandenen Fonds, andrerseits auf dem Weg einer Stiftung des Großherzogs - wie von Palézieux versicherte - aufgebracht werden sollten. Graf Kesslers Mutter hatte ihrerseits formell eine Schenkung von sechzigtausend Francs zugesagt. Harry drängte mich, Vorprojekte und einen ungefähren Kostenanschlag zu machen. Ich konnte nicht verstehen, daß er glaubte, die Vorschläge des Generals seien ernstgemeint, denn ich wußte, daß von Palézieux im Augenblick, in dem er sich zu sehr festgelegt fühlte, neue Projekte vorbringen werde, die ebensowenig zum Ziel führen könnten. Unterdessen verfolgte Harry Kessler einen Plan, der ihm besonders am Herzen lag: eine Ausstellung von Zeichnungen Rodins. In solchen Fällen machte er bedenkenlos Ausgaben und scheute auch vor keinem persönlichen Opfer zurück. ‘Lieber Freund’, schrieb mir Harry am 28. Mai 1906 aus Paris, ‘ich bin überaus glücklich. Ich habe bei Rodin déjeuniert, und er hat mir Hunderte von Zeichnungen gezeigt, damit ich eine Auswahl für das Museum treffen kann. Er hat mir versprochen, dem Museum einen Rodin-Saal zu stiften unter der Voraussetzung, daß er diesen Saal einrichten kann, der die Statue ‘Das Zeitalter der Luft’, Zeichnungen und eine große Zahl von kleinen Gipsmodellen enthalten soll, die vielleicht zum Schönsten gehören, was er geschaffen hat. Nun hängt es von uns ab, daß sich dieser wunderbare Plan | |
[pagina 286]
| |
verwirklicht, denn Rodin hält sein Versprechen. Wir müssen also an einen solchen Saal denken. Rodin war überaus freundlich. Er wünscht, daß ich mit ihm im nächsten Jahr nach Griechenland fahre, um ein Buch mit ihm zu machen. Das heißt, kein Buch über ihn, sondern eine Zusammenfassung seiner Ideen über die Kunst, die man während der Gespräche stenographisch aufnimmt und die als Buch von ihm herausgegeben werden. Finden Sie nicht auch, daß das sehr reizvoll ist? Aber werde ich so lange von Weimar abwesend sein können? Es braucht mindestens sechs Wochen im Dezember und Januar. Rodin hat wunderbare Gedanken, die verlorengehen oder entstellt werden, wenn man nicht darangeht, etwas Definitives aus ihnen zu machen. Ich habe Madame von Sobukew veranlaßt, sich von Rodin porträtieren zu lassen; wir gehen morgen zusammen zu ihm.’ Die Ausstellung der Rodin-Zeichnungen wurde im Januar 1906 eröffnet. Die Blätter gehörten zum Schönsten und Eindrucksvollsten aus den Mappen des Rodinschen Ateliers im Palais Biron, wo sich der Meister vor kurzem eingerichtet hatte. Rodin hatte die Absicht, sämtliche Zeichnungen - alles Aktdarstellungen - dem neuen Museum zu schenken, in das der Dresdner Ausstellungssaal eingebaut werden sollte. Eines der Blätter war als persönliches Geschenk für den Großherzog bestimmt; es war mit einer herzlichen Widmung Rodins versehen. In einer Welle der Begeisterung und Achtung für Rodin hatte die Universität Jena ihm den Ehrendoktor verliehen. Die unschätzbare Großzügigkeit des genialen französischen Bildhauers wurde durch das groteske Eingreifen des Seniors der Weimarer Maler besudelt, die sich in die verrauchten Höhlen ihrer Stammlokale zurückgezogen hatten, wo sie rachsüchtige Pläne schmiedeten. Die Aktzeichnungen lösten bei dem aufgeregten alten Herrn einen Anfall von Schamhaftigkeit aus. Er stürzte auf die Redaktion der in Weimar und im ganzen Großherzogtum meistgelesenen Zeitung. Das ‘Eingesandt’, das am Tag nach der Eröffnung der Rodin-Ausstellung erschien und das den üblichen Vermerk trug: ‘Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung’, lautete: ‘Es ist tief zu bedauern, daß wir im neuen Museum am Karlsplatz von Zeit zu Zeit in den Ausstellungen auf Bilder und Zeichnungen stoßen, die unser Gefühl aufs tiefste verletzen. Es zeugt von einem Tiefstand der Sittlichkeit der Künstler und von einer Laxheit der Auffassung des Ausstellungsvor- | |
[pagina 287]
| |
standes, daß solche Ausstellungen den Weimarer Kunstliebhabern geboten werden, und es herrscht in allen Kreisen darüber eine große Empörung. Ist das Gebotene doch so anstößig, daß wir unsere Frauen und Töchter warnen müssen, die Ausstellung zu besuchen. Daß gerade jetzt eine Reihe von Zeichnungen des französischen Bildhauers Rodin seit Wochen unter dem Bemerken als Widmung des Künstlers an Seine Königliche Hoheit unseren Großherzog ausgestellt werden, ist eine solche Schmach für uns Weimarer, daß wir unsere Stimme dagegen erheben. Es ist eine Frechheit des Ausländers, unserem hohen Herrn so etwas zu bieten, und unverantwortlich vom Vorstande, diese ekelhaften Zeichnungen auszustellen und eine solche Ausstellung zu dulden. Möge der Franzose aus seinem Künstlerkloakenleben sich ins Fäustchen lachen, so etwas in Deutschland an den Mann gebracht zu haben; wir wollen uns das nicht ruhig gefallen lassen und rufen Pfui und tausendmal Pfui über den Urheber und seine Helfershelfer, die solche Abscheulichkeiten uns vor Augen stellen.
H. Behmer, Professor’
Die törichte Prüderie wurde zunächst komisch genommen, und die Witzblätter hatten wieder einmal Stoff für Karikaturen. Trotzdem wurden die Anspielungen des ‘beleidigten’ Professors, es handle sich um pornographische Zeichnungen, zum Vorwand für eine Hetze, die die Widmung Rodins an den Großherzog als eine Beleidigung bezeichnete. Für den Oberhofmarschall und seine Trabanten war es die gefundene Gelegenheit, Harry Kessler als dem Organisator der Ausstellung einen Teil der Verantwortung zuzuschieben, beziehungsweise zu behaupten, er habe die Beleidigung bewußt provoziert. Von diesem Augenblick an warf sich der Oberhofmarschall zum Hüter der öffentlichen Sittlichkeit auf und zum Verteidiger der verletzten Ehre seines fürstlichen Herrn. Pharisäisch plusterte er sich auf. In den Lokalblättern erschien ein Communiqué nach dem anderen, die zweifellos dem auf der Indienreise befindlichen Großherzog zugestellt wurden. Der Oberhofmarschall und der Privatsekretär des Großherzogs wußten als einzige, wo sich der Großherzog aufhielt. Beim Ausbruch des Sturmes befand sich Kessler in London, wohin ihm das ganze Pressematerial geschickt wurde. Er ging sofort zum Angriff über | |
[pagina 288]
| |
und ließ nicht locker, während sein Gegner glaubte, das Opfer schon in seiner Gewalt zu haben. Welche Waffe hatte Harry bereit? Den Brief des Hofsekretariates mit der Bitte, Rodin für das Geschenk an das Museum und für die dem Großherzog persönlich überreichte Zeichnung zu danken. Der Oberhofmarschall behauptete, nichts von einem solchen Schritt zu wissen. Und der Privatsekretär des Großherzogs, Baron von Egloffstein, leugnete - mit gutem Gewissen? -, den Brief geschrieben zu haben. Der Oberhofmarschall verlangte, den Brief zu sehen, vermutlich aus Furcht, der Großherzog könnte sein Manöver durchkreuzen. Harrys Stellungnahme war so kategorisch, daß niemand an ihrer Richtigkeit zweifeln konnte. Aber angesichts der Tatsache, daß der Oberhofmarschall es wagte, den Privatsekretär zu decken, blieb Harry nichts anderes übrig, als den Brief vorzuweisen. Ich spüre noch die Angst, die wir alle ausstanden, denn wir kannten die Unordnung, in der sich seine Korrespondenz, seine Notizen und Manuskripte befanden; hatten wir doch oft genug die Papiermassen sich auf seinem Schreibtisch türmen sehen. Wir suchten in dem Durcheinander, ordneten die Briefe, fanden aber nichts. Vielleicht befand sich der Brief in einem der Hotelappartements in Paris oder London, wo er sich außer seiner Wohnung in Weimar eingerichtet hatte. Auch in Paris und London suchten hilfreiche Freunde. Nach drei Wochen endlich wurde der Brief im Hotel Cecil in London gefunden. Unser Freund war der Gefahr entronnen. Graf Kessler forderte den Oberhofmarschall zum Duell. Aber am Tag, an dem dem Oberhofmarschall die Forderung überbracht wurde, starb von Palézieux plötzlich, noch bevor er sich an den Ehrenrat der Generale in Berlin gewendet hatte. Um die Affäre Rodin wurde es relativ ruhig. Kessler ließ sich in keiner Weise irremachen. Wie stets hatte er eine Menge neuer Pläne im Kopf. Unter anderem beschäftigte er sich mit einer Dünndruckausgabe der deutschen Klassiker in besonders sorgfältiger typographischer Ausstattung und in wertvollem Einband. Es gelang Harry, für die nach dem Großherzog benannte ‘Großherzog-Wilhelm-Ernst-Ausgabe’ unseren gemeinsamen Freund Alfred Walter Heymel zu interessieren, der einen bedeutenden Teil des erforderlichen Kapitals zur Verfügung stellte, und den Insel-Verlag in Leipzig zu bewegen, die Produktion dieser außergewöhnlichen Bände zu | |
[pagina 289]
| |
übernehmen, die in bibliophilen Kreisen großen Eindruck machte und zu anhaltendem Erfolg führte. Ich teilte den Optimismus meines Freundes nicht. Gewiß, er hatte dem Sturm standgehalten und glaubte, den Äußerungen des Großherzogs anläßlich eines Gesprächs kurz vor dessen Abreise nach Indien Vertrauen schenken zu dürfen. In einem Brief Kesslers vom 25. Januar 1906 heißt es: ‘Der Großherzog war sehr freundlich zu mir und erinnerte an das gemeinsame Diner mit Gerhart Hauptmann, das ihm viel Freude gemacht habe. Wir hatten eine Diskussion über Kunstfragen, die er mit Bonhomie und nicht ohne gewisse Intelligenz führte. Er versicherte mir, es sei sein Ziel, die moderne Kunst zu fördern, wenn es ihm auch schwerfalle, gewisse Maler zu verstehen und zu schätzen. Alles in allem hatte ich einen guten, ja sogar sympathischen Eindruck.’ Ungefähr sechs Monate später reichte Harry Kessler seine Entlassung unter Umständen ein, die in Deutschland und jenseits der Grenzen höchstes Aufsehen erregten. Ich war Zeuge der Beleidigung, die der Großherzog Kessler zufügte, seines groben, unmöglichen Verhaltens einem Mann gegenüber, der sich mit Leib und Seele einem Werk gewidmet hatte, das dem Großherzog die höchste Achtung der künstlerischen und intellektuellen Elite Deutschlands und anderer Nationen eingebracht hat. Der vom Großherzog gewählte Augenblick wie die Art und Weise, mit der er Kessler fallenließ, waren grauenhaft. Er war entschlossen, Kessler loszuwerden, ohne ihn anzuhören, ohne ihm Gelegenheit zu geben, sich zu rechtfertigen und die Machenschaften seines nicht mehr faßbaren Gegners aufzudecken. Der ganze Hof war versammelt, um den von seiner Indienreise zurückgekehrten Großherzog zu begrüßen. Die Würdenträger, die hohen Regierungsbeamten und einige Künstler standen in einer Reihe. Der Großherzog schritt die Reihe ab, drückte jedem einzelnen die Hand und wechselte jeweils ein paar Worte. Er kam zu Kessler, blieb stehen, ohne ihm die Hand zu reichen, verzog mit dem Ausdruck offener Verachtung das Gesicht und ging wortlos weiter. Nachdem der Großherzog verschwunden war, blieben die Anwesenden einige Augenblicke wie versteinert stehen. Nur die Mitglieder des engeren Gefolges verließen den Raum mit hochmütiger, triumphierender Miene. Sie hatten von einem verhaßten Rivalen nichts mehr zu fürchten. | |
[pagina 290]
| |
Die Nachricht von der Demission Kesslers verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Beflissene Berichterstatter prophezeiten das Ende des ‘neuen Weimar’ und meldeten schon am übernächsten Tag meinen und Ludwig von Hoffmanns Rücktritt. Wir besprachen uns sofort über diese Frage und waren beide entschlossen, Kessler in die Ungnade zu folgen. Aber unsere Freunde in Weimar und auswärts drangen in uns, auf unseren Posten zu verbleiben. Kessler machte uns die Entscheidung leicht. Auch er bat uns dringend, auszuharren, unseren Gegnern die Stirn zu bieten und den kommenden Ereignissen entgegenzusehen. Wir folgten diesen Wünschen und benützten jede Gelegenheit, um uns mit allem, was Kessler in Weimar und für Weimar geschaffen hatte, solidarisch zu erklären. Es schien, als ob einer der Grundpfeiler des von uns mit so leidenschaftlicher Begeisterung errichteten Gebäudes eingestürzt sei. Kessler war der Meinung, daß der Bruch zwischen ihm und dem Großherzog keineswegs den Verzicht auf den Ausbau eines internationalen künstlerischen und literarischen Zentrums in Weimar bedeute. So wurde die ganze Affäre nur zu einem ‘Zwischenfall’, der dem ‘neuen Weimar’ wohl einen Schlag versetzte, sein Bestehen aber in keiner Weise in Frage stellte. ‘Unter keinen Umständen’, schrieb mir Kessler, ‘darf sich unser Kreis auflösen. Wir werden aus Weimar das Kunstzentrum, das internationale Kunstzentrum machen, wie wir es uns vorgenommen haben. Ich rechne bestimmt damit, mich jedes Jahr drei oder vier Monate in Weimar aufzuhalten. Endlich werde ich von Scherereien und Klatsch verschont bleiben. Vielleicht wird es uns mit der Zeit gelingen, einen Saal für Ausstellungen zu finden, bei denen wir nichts mehr von der offiziellen Clique zu fürchten haben werden. Vielleicht können wir dort auch Konzerte veranstalten...! Denken Sie darüber nach, mein Lieber. Wir sehen uns in spätestens vierzehn Tagen, bevor ich zu einer Übung einrücken muß!’ | |
Die Weimarer KunstgewerbeschuleDie Errichtung meines Institutes für Kunstgewerbe und Kunstindustrie bedeutete den Abschluß meine Zusammenarbeit mit dem Großherzog, die | |
[pagina 291]
| |
auf der Zuneigung und Achtung beruhte, welche ich ihm ursprünglich entgegengebracht hatte. In völliger Unabhängigkeit erfüllte ich meine Aufgabe als Leiter des Institutes, das erst im Jahre 1912 in die Hand des Staates überging. Die offizielle Bestätigung des bewilligten Betrages, den ich für den Bau einer großherzoglichen Kunstgewerbeschule angefordert hatte, deren Pläne schon lange vorlagen, erhielt ich (1906) nach der Rückkehr von einem Aufenthalt in Schwarzburg. Der Großherzog stellte mir ein Terrain und die für den Bau notwendigen Mittel zur Verfügung. Die Regierung versprach mir einen jährlichen Beitrag, dessen größten Teil der Großherzog zu seinen Lasten übernahm. Andrerseits wendete ich mich um finanzielle Unterstützung an eine Reihe von Freunden und nahm in den ersten Jahren des Institutes materielle Opfer auf mich, die mir meine eigene materielle Lage eigentlich nicht erlaubte. Im Gegensatz zum üblichen Vorgehen war es mir nicht in den Sinn gekommen, für die neue Schule einen Lehrplan aufzustellen und zu veröffentlichen. Ich wäre in große Verlegenheit gekommen, wenn ich ein Programm hätte aufsetzen sollen. Welches Mindestmaß von Kenntnissen hätte ich verlangen sollen? Nichts als ein Zeugnis über abgeschlossene Schulbildung, die zur Verständigung zwischen Lehrer und Schüler genügte! Ich wollte den Unterricht der Weimarer Kunstgewerbeschule auf die Beziehung zwischen Meister und Lehrling gründen, wie sie in den großen Zeiten des Kunsthandwerks bestand. Das wechselseitige Spiel, das sich zwischen mir und den Kunsthandwerkern bei der gemeinsamen Arbeit im ‘Kunstgewerblichen Seminar’ entwickelt hatte, bestärkte meine Überzeugung, daß nur in der belebenden Atmosphäre gegenseitiger Achtung und im gemeinsamen Bestreben, die Dinge so gut wie nur möglich zu machen, der Wille zum Vollendeten entstehen könne, der in den Räumen der neuen Schule herrschen sollte. Die großherzogliche Schule hätte eigentlich Werkstatt oder Laboratorium und die Schüler hätten Laboranten genannt werden sollen, eine Bezeichnung, die sie mit Stolz hätten tragen können. Eine der Hauptaufgaben der Schule sah ich darin, die unvollständige Arbeitsgruppe, die ich in Weimar vorgefunden hatte, zu ergänzen. Im Verlauf von drei oder vier Jahren sollten auf Grund eines strengen Unterrichts fähige Zeichner und Mo- | |
[pagina 292]
| |
delleure herangebildet werden, um den Schlendrian zu beseitigen, der in Deutschland wie in allen anderen mitteleuropäischen Ländern die undurchsichtigen Bereiche der Konkurrenzwirtschaft beherrschte, deren mit dem Stigma ‘billig und schlecht’ belastete Produkte von Neuigkeit zu Neuigkeit gehetzt wurden. In der Erziehung nach den Prinzipien vernunftgemäßer Gestaltung sah ich hingegen die Möglichkeit, adäquate, funktionelle Formen und organische Ornamente zu entwickeln, mit denen die Industrien die Aufmerksamkeit des abgestumpften Publikums erregen und den sinnlosen Übertreibungen einer uferlosen Phantasie Einhalt gebieten konnten. Wenn in einigen Jahren ein einziger guter Buchbinder, Keramiker, Ziseleur, Weber von Möbelstoffen und Teppichen oder ein Möbelentwerfer aus der Kunstgewerbeschule hervorgehen und zu unserer Arbeitsgruppe stoßen würde, wäre der Kampf um so leichter gewonnen, als andere Schüler an anderen Stellen unsre Position verstärken und in neu zu schaffenden Werkstätten der verschiedensten kunstgewerblichen Zweige positive Funktionen übernehmen könnten. Die neue Kunstgewerbeschule und ihre Ziele wurden erst einige Monate nach ihrer Gründung in der Presse besprochen. Die Öffentlichkeit reagierte in verschiedener Weise auf die pädagogischen Methoden, die sich von den Lehrprinzipien anderer Kunstgewerbeschulen so grundsätzlich unterschieden. Beim Aufbau meines Institutes war ich vom Hof wie auch von der Regierung so unabhängig, daß beide Instanzen erst allmählich durch Zeitungsartikel über meine Maßnahmen unterrichtet wurden. Weder der Großherzog noch die Regierung gaben irgendwelche Zeichen der Billigung. Sie zeigten aber auch nicht die geringste Gegnerschaft. Man begriff nur langsam, daß Weimar ein einzigartiges und in seiner Art erstmaliges Institut besaß, das radikal auf jede Stil-Imitation verzichtete. Die revolutionäre künstlerische Bewegung hatte gleichsam in der Stille ihre feierliche Investitur erhalten. Mein Weimarer Institut, auf dem die Fahne des Aufstandes wehte, war die fortschrittlichste Zitadelle der neuen künstlerischen Prinzipien. Von hier aus konnten die Fundamente der veralteten offiziellen Pädagogik erneuert, die Gunst des Publikums gewonnen, und von hier aus konnten schließlich die Weltmärkte erobert werden. Solange mir nur das ‘Kunstgewerbliche Seminar’ zur Verfügung stand, mußten notgedrungen die For- | |
[pagina 293]
| |
schungsergebnisse und die aus den Werkstätten hervorgehenden Arbeiten ganz betont den Stempel meiner Persönlichkeit tragen. Während meiner Lehrjahre als Pädagoge bin ich mir über viele Dinge klargeworden. So konnte ich meinen Schülern künstlerische Gesetze vermitteln und sie auf die eiserne Disziplin der vernunftgemäßen Gestaltung verpflichten. Der Schüler unterwarf sich dieser Forderung um so leichter, als von ihm keine Kenntnisse der vergangenen Stile verlangt wurden. Er wurde nicht mit den Produkten der Vergangenheit bekannt gemacht, sondern geschult, das Wesentliche der Form der verschiedensten Gegenstände zu erkennen, eine pädagogische Methode, die sich nur auf die Ergebnisse von Analysen und praktischen Werkstätten-Erfahrungen stützen kann. Von diesem Augenblick an war die vernunftgemäße Gestaltung die einzige Quelle, aus der die Schüler bei der Lösung konstruktiver Probleme oder bei der Erfindung von Formen und Ornamenten schöpfen konnten. Die Atmosphäre in den Werkstätten und Laboratorien war intensiv, sprudelnd und frei von jeder Unsauberkeit. Wenn ich sie mir wieder vergegenwärtige, spüre ich ihren frischen Wind, der etwas von Meeres- oder Gebirgsluft hatte. Die Schüler und Schülerinnen arbeiteten in weißen Mänteln, wie sie die Ärzte oder Schwestern in Spitälern tragen. Alle Arbeiten - gedanklich und praktisch - wurden gleichsam mit der hygienischen Sorgfalt ausgeführt, die einem fröhlich begrüßten Neugeborenen entgegengebracht wird. Im Lehrplan gab es weder kunstgeschichtliche noch stilgeschichtliche Kurse. Sie hätten nur Belastung bedeutet und den Schüler von dem von mir vorbezeichneten Weg ablenken können. Die Ausbildung beruhte auf folgenden Grundlagen: 1. Technisches Zeichnen, jeweils der handwerklichen Gattung entsprechend, 2. Farbenlehre, angewendet auf die verschiedenen Handwerkszweige, und 3. die Ornamentlehre, die auf Grund der dynamographischen, abstrakten Gesetze den verschiedenen Handwerksgattungen die Motive liefert. Ich hatte einen Assistenten für den Unterricht im technischen Zeichnen und eine Assistentin für die Farbenlehre, die mir auch im Ornamentkurs behilflich war. Mir selbst stellte ich die Aufgabe, im Zuge meiner Untersuchungen und Entdeckungen die Gesetze einer rationalen Ästhetik aufzuzeigen und zu formulieren, befreit von den läppischen Definitionen und sterilen, nebulosen und künstlichen Prinzipien, deren sich die Ästhetiker offizieller akademischer Observanz bedienen. | |
[pagina 294]
| |
Im großen Atelier, in dem die Kurse über Ornamentzeichnen und über die Farbenlehre gegeben wurden, fanden die Schüler nichts als ein halbes Dutzend von Gipsabgüssen nach von mir geschaffenen Ornamenten vor. Außerdem Blumen und Blätter, die für Kompositions- und Harmonieübungen der Teilnehmer am Farbkurs bestimmt waren. In den Lehrplan war die Architektur nicht einbezogen, obgleich ich damals die Kraft in mir spürte, mit fähigen Hilfskräften die Institutsaufgaben in dieser Richtung zu erweitern. Ich wollte aber die ursprünglich gesetzten Grenzen nicht überschreiten, die dem Institut als einem Instrument zur Hebung der kunsthandwerklichen und kunstindustriellen Produktion Sachsen-Weimars gesetzt waren. Zudem reichten die mir vom Großherzog zur Verfügung gestellten Mittel nicht zum Aufbau einer Architekturabteilung aus, wie ich sie mir vorstellte. Hier wäre eine direkte Verbindung mit einer Universität oder einer Technischen Hochschule notwendig gewesen, weil meiner Meinung nach die Zusammenarbeit der zukünftigen Architekten mit Ingenieuren unerläßlich ist. Mehr konnte man in Deutschland von einem kleinen Institut nicht erwarten, und es wäre falsch gewesen, mehr scheinen zu wollen. Die Schule besaß eine Folge von Räumlichkeiten, die bei der Einweihung - im ersten Schuljahr 1907/08 hatten sich siebenundzwanzig Schüler eingeschrieben; 1914, beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges, waren es gegen achtzig - als zu zahlreich erschienen. Im Erdgeschoß befanden sich die beiden geräumigen Ateliers des Seminars, eines für die Zeichner, das andere für die Modelleure. In einem sehr großen Saal arbeiteten an langen Tischen die Schüler aller Jahrgänge zusammen, wobei die fortgeschrittenen die jüngeren korrigierten und anregten. Überall standen Vasen und Schalen mit Blumen, Früchten und Pflanzen, die als Material für Harmoniestudien und abstrakte Farbkompositionen dienten. Der Schüler bestimmte den Rhythmus. Der Lehrer leitete den Kurs auf Grund der jüngsten Forschungen auf dem Gebiet der Farbe durch den französischen Physiker Chevreul, die Amerikaner N.O. Rood und Maxwell und den Professor an der Sorbonne, Charles Henry. Für Farbkurs war Fräulein Dora Seeligmüller meine Assistentin. Sie half mit besonderer Geschicklichkeit und außergewöhnlicher Sensibilität den Schülern bei ihren Arbeiten. Eine Sammlung der schönsten Beispiele der in | |
[pagina 295]
| |
diesen Kursen entstandenen abstrakten Kompositionen verblieb im Archiv des Institutes, solange ich die Direktion innehatte. Die gleichen Schüler führten unter Leitung von Fräulein Dora Wibiral im selben großen Atelier Ornamente aus, die sie auf Grund der von mir entdeckten Gesetze entwickelten. Ich selbst beschäftigte mich mit meiner Mitarbeiterin mit dem Wesen der Linie und mit den Gesetzlichkeiten ihrer abstrakten und struktodynamographischen Kräfte. Neben diesen Ateliers befand sich ein besonderer Raum, der den Schülern zur Verfügung stand, die allein arbeiten oder ungestört über bestimmte Arbeiten oder Probleme nachdenken wollten. Zwei große Ateliers standen Fräulein Helene Börner zur Verfügung für ihre verschiedenen Webstühle und Vorrichtungen zur Herstellung von Knüpfteppichen. Im gleichen Flügel des Gebäudes, ebenfalls im Erdgeschoß, befanden sich die Werkstätten für Metallbearbeitung und Lampenbau sowie das Atelier für Goldschmiedekunst, dem Albert Feinauer als Lehrer vorstand. Als Goldschmied und Ziseleur war er damals einer der ersten. Er hatte von meinen Plänen, in Weimar Werkstätten einzurichten, gehört und bot sich für eine probeweise Beschäftigung an. Damals mag er ungefähr fünfundzwanzig Jahre alt gewesen sein. Er führte nach meinen Entwürfen eine Reihe von Teeservicen aus, die handwerklich unvergleichlich sind und zum besten gehören, was ich in meinem Leben geschaffen habe. In dem zur Straße im rechten Winkel gelegenen Flügel war die keramische Werkstatt mit einem großen Brennofen und kleineren Laboratorien untergebracht, in dem der Kunstschule gegenüberliegenden Flügel die Gießereiwerkstätte, die auch den Bildhauern der Kunstschule zur Verfügung stand. In ihr wurden auch die Metallteile hergestellt, die bei meinen Möbeln und sonst bei meinen Bauten Verwendung fanden. Im Obergeschoß des Vertikalflügels hatte ich mein sehr großes Privatatelier und Räume für meine Assistenten. Daneben lagen die Werkstätten für Buchbinderei, graphische Künste und Vorsatzpapiere sowie für Batik. Die Stunden, die ich in den Ateliers für Keramik, Buchbinderei und Goldschmiedekunst verbrachte, bedeuteten für mich eine besondere Erholung. So sehr ich die beiden letzteren liebte, so stark fühlte ich mich gerade von der keramischen Arbeit angezogen. Hier konnte ich in direktem Zusammenhang mit Töpferscheibe und Brennofen praktische Versuche anstellen; ich veränderte Profile und Formen, um den Prozeß der Glasuren zu be- | |
[pagina 296]
| |
schleunigen oder zu verlangsamen; ich unterbrach ihn durch vorspringende Elemente und leitete die Glasuren in Rillen, um das Tempo des Flusses der Glasuren zu regeln. Um die Temperaturen zu verändern, verwendete ich Feilspäne und Messing- oder Kupferdrähte, die - je nachdem die Hitze weniger oder mehr als tausend Grad betrug - zu grünen oder roten Färbungen führten: zu jenen roten Ochsenblutfarben, die die japanischen und chinesischen Keramiker über alles schätzten. Ich nahm an der geduldigen und exakten Arbeit des Buchbinders Dorfner teil, an der ich vor allem die Feinarbeit der Goldpressung liebte. Als Dorfner an die Schule kam, war er noch ein Anfänger. Er entwickelte sich rasch zu einem der tüchtigsten Meister dieses schönen Handwerks, für das sich zu Anfang des Jahrhunderts vor allem in England, Frankreich und Belgien eine Reihe eifriger und reicher Sammler interessierte. Mit seinen Schülern schuf Dorfner die Einbände für die Luxusausgaben des Insel-Verlages, für die ich die ornamentale Ausstattung entwarf. Nicht zu vergessen die Einbände seiner Schülerin Else von Guaita, die vielleicht die Perfektion ihres Meisters nicht ganz erreichte, ihm aber an künstlerischer Sensibilität überlegen war. Alljährlich kam der russische Bildhauer und Holzschneider M. Kogan zu Kursen an die Kunstgewerbeschule. Er war ein hochtalentierter und kultivierter Künstler von außergewöhnlich sicherem Geschmack, aber unvorstellbar faul. Ehrgeiz oder Neid kannte er nicht. Seine bildhauerische und zeichnerische Begabung stand der Maillols nicht nach, aber er beschränkte sich auf Plastiken in kleinem Format, weil ihm die Kraft und Ausdauer für das große Format fehlten. Seine Zeichnungen besaßen eine Noblesse und Sensibilität der Linie, wie sie in diesem Maß bei kaum einem seiner Zeitgenossen zu finden waren. Ich hätte ihn an sich gerne meinem Institut als ständigen Lehrer verbunden. Sein Einfluß vor allem auf die Entwicklung der künstlerischen Sensibilität wäre in allen Abteilungen heilsam und fruchtbar gewesen. Aber ich fürchtete, er könnte die strenge Disziplin der vernunftgemäßen Gestaltung nicht akzeptieren, auf der das Institut aufgebaut war. Persönlich war Kogan sehr kultiviert, ganz und gar nicht Bohemien, eine offene Natur. Er redete ungeheuer viel, und es war schwer, seinen Redestrom zu unterbrechen, weshalb ich ihm den Zugang in mein Privatatelier verwehrte. | |
[pagina *45]
| |
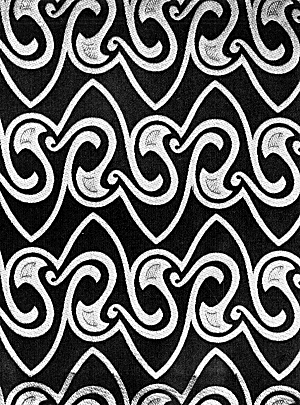
84 Stoffmuster

85 Tisch aus dem ‘Hohenhof’ in Hagen
| |
[pagina *46]
| |
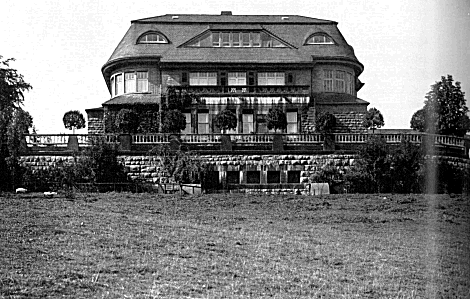
86 Osthaus' Wohnhaus ‘Hohenhof’ in Hagen, 1906/08

87 Arbeitszimmer im ‘Hohenhof’
| |
[pagina *47]
| |

88 Ida Gerhardi: Karl Ernst Osthaus, 1903
| |
[pagina *48]
| |
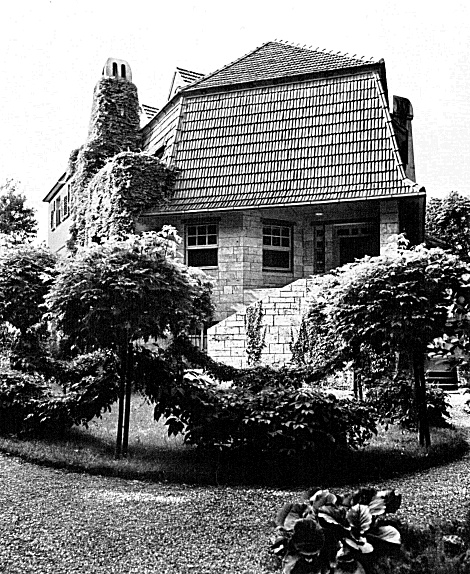
89 Haus ‘Hohe Pappeln’ in Ehringsdorf bei Weimar, 1906/07
| |
[pagina 297]
| |
Nach einigen Jahren hatte die Kunstgewerbeschule den Beweis ihrer Lebensberechtigung erbracht. Und immer noch verzichtete ich auf die Formulierung eines Programms. Wenn sich ein Schüler anmeldete, interessierten mich in erster Linie sein Charakter und seine Begabung. Den jungen Menschen, die von offiziellen Kunstschulen kamen, mißtraute ich trotz all ihrer lauten Begeisterung für meine Ideen und Prinzipien, die sie vielleicht in einem von mir gehaltenen Vortrag, in Zeitschriftenartikeln oder in meinen Büchern kennengelernt hatten. Bis zum Beweis des Gegenteils betrachtete ich sie als von falschen Grundsätzen infiziert. Im Laufe der Jahre stieg die Zahl der Schüler ständig. 1913, bei der Feier meines fünfzigsten Geburtstages, begrüßten mich in meinem Atelier achtzig junge Menschen: siebenundzwanzig aus dem Großherzogtum, drei aus anderen thüringischen Ländern, zweiundvierzig aus den übrigen Teilen Deutschlands und acht Ausländer. | |
Haus ‘Hohe Pappeln’In jener Epoche betrachtete ich die Entwicklung des Weimarer Institutes als mein wichtigstes Lebensziel. Mit seinen Werkstätten war es das wirksamste Mittel zur Verwirklichung meiner Aufgabe und zur Propaganda meines Apostolates. Ich liebte das kleine Land, als ob es mein eigenes wäre, und fühlte mich an Weimar gebunden. Trotzdem hatte ich geistige Schwierigkeiten, mich einzuordnen. Im Grunde konnte es zu keiner geistigen Assimilierung kommen. Mein Charakter und meine Ansichten waren von Natur aus dem Wesen der an den Hof gebundenen Menschen zu entgegengesetzt, und auch den Weimarer Künstlern, die nicht verstanden, was ich liebte und wollte, fühlte ich mich fern. Die materielle Eingliederung gelang mir rascher und leichter. Ohne mir über die Zukunft meines Schaffens Gedanken zu machen, beschloß ich nach einigen Jahren meines Aufenthaltes, mir außerhalb der Stadt ein Haus zu bauen. Ich wählte einen Platz in Ehringsdorf, auf dem sich eine Gruppe ungewöhnlich hoher, majestätischer Pappeln befand. Sie gaben diesem Haus den Namen. ‘Das Haus unter den hohen Pappeln’, so betitelte eines Tages | |
[pagina 298]
| |
mein Sohn Thyl unsere Wohnstätte. Seitdem wurde unser Haus unter diesem Namen bekannt. Ich habe ihn oft aus dem Mund erstaunter und auch schockierter Spaziergänger gehört, die sich über seine ungewohnte architektonische Form aufregten, während ich mich, ihnen unsichtbar, im Garten befand. Auch die Kutscher benannten das Haus so. Wenn sie mit Fremden auf der Besichtigungsfahrt durch Weimar zu dem Haus kamen, hielten sie oft an, weil die Straße steil anstieg, reihten das Haus unter die Kuriositäten der Stadt ein und erzählten in lakonischen und stereotypen Sätzen einiges über mein Leben und meine Rolle in Weimar. Sehr oft endete die kurze Erzählung mit einem unverdienten Lob auf meinen Charakter, vielleicht weil ich gelegentlich etwas großzügigere Trinkgelder gab, als es in Weimar üblich war. In diesem Haus wuchsen meine fünf Kinder heran in der Unschuld und Fröhlichkeit eines sorglosen Lebens ohne Krankheiten, ohne konventionellen Zwang und ohne von allzuviel Arbeiten gequält zu werden, in der Fülle ihrer Kräfte und in der freien Entwicklung ihres Wesens. Ich selbst habe es dem Haus ‘Hohe Pappeln’ zu danken, daß ich über eine gewisse Isolierung in der kleinen Residenz abseits der großen Zentren, in die mich mein wachsender Ruf und auch materielle Vorteile hätten ziehen können, leichter hinwegkam. Ich war so intensiv mit dem Aufbau der Kunstgewerbeschule beschäftigt, daß ich, auch von da aus gesehen, keine Enttäuschung oder Verbitterung empfand. Ich widmete mich, wie mir schien, der denkbar schönsten Aufgabe, mit der das Glück verbunden war, mit jungen Männern und Mädchen zusammenzuarbeiten, die, glühend wie ich selbst, einem Ideal folgten, das ich vor ihren Augen hatte erscheinen lassen. | |
Frauen in WeimarSehr viel rascher, als wir glaubten hoffen zu dürfen, erweiterte sich der Kreis um das ‘neue Weimar’, der mit Kessler seinen glänzendsten Vertreter verloren hatte. Elisabeth Förster-Nietzsche versuchte, die Kesslersche Tradition der ungezwungenen Geselligkeit, der Déjeuners und der Empfänge fortzusetzen. Als wir, meine Frau und ich, uns im Haus ‘Hohe Pap- | |
[pagina 299]
| |
peln’ eingerichtet hatten, sahen auch wir die Freunde dieses Kreises bei uns. Die unteren Räume unseres neuen Hauses eigneten sich ebensogut für intime Zusammenkünfte wie für größere Gesellschaften. Die Schriftsteller Johannes Schlaf und Paul Ernst, die ebenfalls nach Weimar übergesiedelt waren, hielten sich außerhalb unsres Kreises, weil ihre Art zu leben sich von der unseren unterschied. Aber auch sie glaubten an den Aufstieg Weimars und fühlten sich als Mitstreiter. Man sah sich, aber man kam nicht zusammen. Hier fehlten uns Richard Dehmel und seine Frau, die die Verbindung hätten herstellen können. Auch Alfred von Nostitz-Wallwitz war mit seiner jungen Frau Helene, geborene von Hindenburg, nach Weimar gezogen. Sie war eine Enkelin des Fürsten Münster, des ersten deutschen Botschafters nach dem Siebzigerkrieg. In der Atmosphäre französischen Kunst- und Geisteslebens aufgewachsen und erzogen, war sie die Personifikation der Synthese deutscher und französischer Kultur. Der Dichter Ernst Hardt, der durch den enormen Erfolg seines Schauspiels ‘Tantris der Narr’ in die erste Reihe der deutschen Dramatiker nach Gerhart Hauptmann und Wedekind gelangt war, wohnte mit seiner jungen Frau Polyclète de Eslin in einer mit erlesenem Geschmack eingerichteten Villa ‘Am Horn’. Der ausgezeichnete Pianist Walter Lampe und seine Frau Else von Guaita, die in die Buchbinderwerkstatt der Kunstgewerbeschule eintrat, kamen von München und schlossen sich dem Kreis der intellektuellen und künstlerischen Elite an, die innerhalb Deutschlands höchstens in Berlin ihresgleichen suchen konnte. Die Götter scheinen ihre Hände über die jungen Frauen unseres Kreises gehalten zu haben, und die Feen haben Blumen auf ihren Weg gestreut. Poly Hardt, Helene von Nostitz, Elly von Hofmann, meine Frau, Erica von Scheel und Else von Guaita waren Schönheiten. Eine ‘Corona’, die den verwöhntesten Ansprüchen standhielt. Schönheiten ganz verschiedener Art: Erica von Scheel der Typus der Nordländerin, während Elly von Hofmann, eine Tochter des Berliner Archäologen Kekule von Stradonitz, das vollendete Beispiel römisch-klassischer Schönheit war. Auf der anderen Seite meine Frau mit allen Merkmalen keltischer Herkunft: blaßblaue, kühle, gletscherfarbene Augen, weizenblonde Haare, eine ruhige, distanzierte Haltung. Helene von Nostitz wiederum glich einer Walküre; so frühreif ihre Erscheinung war, so unverändert blieb ihr Leben lang die Spannkraft ihrer | |
[pagina 300]
| |
Bewegungen; immer war sie auf der Suche nach neuen künstlerischen Erlebnissen. Polyclète de Eslin, Ernst Hardts Frau, war in Athen im Kreis des Premierministers Venizelos aufgewachsen, eine kleine, schlanke Gestalt mit Gesichtszügen wie eine Meißener Porzellanfigur, eine außergewöhnlich offene, lebhafte und vornehme Natur. Else von Guaita war von verwirrender, ausgesprochen exotischer Schönheit und hätte eine Zigeunerin oder eine Beduinin gewesen sein können. Sie kam aus einer vor langer Zeit aus Italien nach Frankfurt eingewanderten Bankiersfamilie. In ihren Zügen, in denen keine Spur von Germanischem zu entdecken war, mischte sich Exotisches mit Altflorentinischem. Ohne eigentlich schöpferisch zu sein, besaß sie einen höchst verfeinerten Geschmack und eine für alles Schöne wache Sensibilität. Von Else von Guaita erhielt ich einen Band mit Sonetten Platens, in den sie zum Gedicht ‘Tristan’ ein Buchzeichen gelegt hatte. Ich ließ dieses Gedicht von einer Schülerin des kalligraphischen Kurses abschreiben. In einem kleinen Rahmen hat es mich mein Leben lang begleitet; wo ich auch war, befand es sich über meinem Bett. ‘Wer die Schönheit angeschaut mit Augen,
Ist dem Tode schon anheimgegeben,
Wird für keinen Dienst der Erde taugen,
Und doch wird er vor dem Tode beben,
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen.’
Alle diese jungen Menschen gaben der Atmosphäre, in der ich lebte, einen Zauber besonderer Art. Unter ihnen nahm Erica von Scheel einen besonderen Platz ein. Sie war meine erste Schülerin und wie Sigurd Frosterus mit größter Begeisterung bei der Sache. Und wie Sigurd trat sie in freundschaftliche Beziehungen zu meiner Frau und den Kindern, die sie vergötterten. Das Wichtigste aber: sie war hochbegabt. Als erste führte sie Arbeiten in Batiktechnik aus, die von meinem Freund Thorn Prikker aus Java importiert worden war. Ich war über den Arbeitsvorgang gut orientiert und konnte Erica von Scheel bis in alle Details der Technik informieren, ohne sie selbst ausführen zu können. Bei anderen Handwerksgattungen, in deren Praxis ich mich einzuleben hatte, erging es mir ähnlich. Für Batik interessierte ich mich besonders. Thorn Prikker hatte mir seine Sammlung gezeigt, und ich kannte und bewunderte schon vor 1900 die herr- | |
[pagina 301]
| |
lichen Batikstoffe der ethnographischen Museen in Rotterdam und Leyden. Die in Weimar entstandenen Stoffe unterschieden sich von den traditionellen, geometrischen Motiven der javanischen ‘Sarongs’ durch eine Formensprache, die auf Grund meiner Theorie der dynamischen Linie entwickelt wurde. Die geometrischen Gebilde der klassischen javanischen Batiken sind bedingt durch die Verwendung der kleinen, muschelartigen ‘Jantings’, mit denen die kleinen Finger der Javanerinnen arbeiten und aus denen wie aus dünnen, schnabelartigen Röhren das gewärmte, flüssige Wachs fließt. Die europäischen Frauen fanden Gefallen an diesen javanischen Ornamenten. Die Herren der ‘Haute Couture’ wollten aber linear-dynamische Ornamente haben, an deren Zukunft sie glaubten. Der bekannteste unter ihnen, Paul Poiret in Paris, hatte mich zu einem Besuch aufgefordert, weil er mir einen Teil der Ausstattung seiner Geschäftsräume übertragen wollte. Bei meinem Besuch zeigte ich ihm die Batikarbeiten Erica von Scheels, die in ihrem dekorativen Reichtum und der Pracht der Ausführung unvergleichlich waren. Poiret war entzückt und wünschte, Erica von Scheel in Paris zu haben. Erica stimmte zu und zog in eines der Gebäude der ‘Communs’ des Palais Biron, wo Rodin vor kurzem sein Atelier eingerichtet hatte, in dem seine stürmische Produktivität den gemäßen Raum fand. In den ‘Communs’ wohnte eine Reihe von Künstlern, meist Ausländer, unter denen sich Rilke und Ivo Hauptmann befanden, der Schüler meines Freundes Paul Signac geworden war. Nach einiger Zeit heirateten Erica und Ivo. Mit Rilke blieben sie zeitlebens in Freundschaft verbunden. Zwei Jahre hatten Ericas Arbeiten bei der Pariser und internationalen Kundschaft Poirets großen Erfolg. Aber die Mode ist unbeständig und haltlos. Als meine Jüngerin war Erica nicht bereit, ihre künstlerischen Ideale zu opfern und den Kompaß, auf den sie ihr Leben eingestellt hatte, nach den wetterwendischen Schwankungen und Launen des Pariser Geschmacks zu richten.
Auf dem Schachbrett, auf dem die Partie zwischen dem abtrünnigen Großherzog und unserem Kreis gespielt wurde, blieb der Vorteil auf unsrer Seite. Unter den Neuankömmlingen spielte das schon erwähnte Ehepaar von Nostitz eine große Rolle. Alfred von Nostitz war zum sächsischen Gesandten in Weimar ernannt worden. Daß man einen Ästheten statt eines | |
[pagina 302]
| |
Routinediplomaten gewählt hatte, war ebenso bezeichnend wie die Ernennung des Grafen Prozor zum russischen Gesandten. Prozor war ein bekannter Schriftsteller; er hatte Ibsens ‘Nora’ ins Französische übersetzt. Alfred von Nostitz gehörte zu den ersten Besuchern unsres Hauses ‘Bloemenwerf’ in Uccle. Ich hatte ihm für seine Berliner Junggesellenwohnung die Einrichtung entworfen und ihn in Paris zu den Kunsthändlern mitgenommen, bei denen er herrliche moderne Werke erwarb. Jetzt befand sich all das in Nostitzens Villa an der Tiefurtallee. Rodin hatte vor kurzem die Büste Helenes geschaffen, die neben dem Porträt von Natascha Golubeff zu seinen schönsten Werken gehört. Es war Helenes Lebensinhalt, Künstler, Schriftsteller und Musiker um sich zu haben und ihr eigenes und das Leben anderer dadurch zu bereichern. In ihrem Buch ‘Vom alten Europa’ stellt sie das Leben unseres Weimarer Kreises in den Jahren 1908 bis 1910 dar. Als ich es las, erinnerte ich mich unseres Bedauerns, daß Helene und Alfred Weimar verließen, um nach Wien zu gehen, wo Alfred einen Gesandtenposten erhalten hatte. Einladungen, Feste und Vorträge reihten sich in ununterbrochener Folge. In einer nächtlichen Vorstellung wurde uns im Garten der Villa Nostitz Ernst Hardts ‘Ninon de Lenclos’ vorgespielt. An einem anderen Abend tanzte auf dem von Scheinwerfern erleuchteten Rasen eine Tänzerin. Es wurde musiziert, es wurde gelesen. Walter Lampe setzte sich an den Flügel, Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke trugen Gedichte vor... Nach den verwünschten Zeiten des Nazismus und des Krieges beschrieb Karl Scheffler in seinen Lebenserinnerungen ‘Die fetten und die mageren Jahre’ die neuweimarische Periode und gestand nur mir zu - er hätte sagen sollen ‘uns’ -, daß für mich das Wort Kultur kein leeres Wort, sondern eine Realität bedeutete, und daß die Lebensformen, die mir vorschwebten, als griechisch oder amerikanisch hätten bezeichnet werden können. Bei dieser Gelegenheit macht aber Scheffler unseren von England übernommenen gesellschaftlichen Stil lächerlich, wenn wir bei unseren gemeinsamen Diners und Soupers im Smoking - Scheffler schreibt ‘Frack’ - erschienen. Dies sei alles Komödie gewesen, und wir hätten nur mit Handschuhen oder mit Fingerspitzen unter komplizierten, verkünstelten Worten die wirklichen Probleme berührt. Ich wende mich gegen seine Darstellung unsres Lebensstils, weil sie ihn | |
[pagina 303]
| |
bösartig ironisiert und entstellt. Vor allem aber, weil sie zwischen mir und meinen Freunden und Gesinnungsgenossen einen Trennungsstrich zieht, wenn Scheffler schreibt: ‘Der einzige, der in diesem parfümierten Milieu in all seiner Eleganz natürlich und naiv blieb, war van de Velde selbst.’ Ich hoffte, mich eines Tages noch mit Scheffler über seine Vorwürfe aussprechen zu können; sein Tod hat es unmöglich gemacht, und ein schöner Brauch will es, daß die Toten nicht zur Verantwortung gezogen werden. | |
WanderausstellungenIm Herbst 1906 erhielt ich verschiedene Einladungen von kunstgewerblichen Vereinigungen und von Museumsdirektoren zu Ausstellungen meiner Arbeiten aus den verschiedenen Gebieten des Kunsthandwerks und der Kunstindustrie. In Stuttgart, Bremen, Zürich, Oslo, Kopenhagen und Trondheim wünschte man, eine repräsentative Auswahl von Werken zu sehen, die ich selbst geschaffen hatte, und von solchen, die im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit in Weimar entstanden waren. Ich stellte das Material für eine Wanderausstellung zusammen, das je nach dem Ausstellungsort ergänzt werden konnte. Diese Wanderausstellung, die im Laufe des Jahres 1907 zirkulierte, wurde in den verschiedenen Städten von der Kritik sehr günstig beurteilt. Einige der besten und charakteristischsten Beispiele meines Schaffens wurden vom Museum in Trondheim im hohen Norden Europas erworben und in einem eigens dazu bestimmten Saal aufgestellt. Diese Erfolge, die auch meinen Mitarbeitern und Helfern zugute kamen, schmeichelten der Eitelkeit der Bevölkerung der Residenz und des Landes. Die verschiedenen Instanzen, die mit meiner Tätigkeit verbunden waren, fühlten sich bestätigt, und der Nutznießer war - in gewissem Maß - der Großherzog, den man lobte, daß er mich berufen und durch seine Großzügigkeit die neue Entwicklung ermöglicht hatte. Ob der Großherzog von seinem Privatsekretär oder von einer anderen Instanz über die Erfolge der Wanderausstellung unterrichtet wurde, weiß ich nicht. Er distanzierte sich mehr und mehr von allem, was sich in seinem Land ereignete, und sein Interesse für meine Tätigkeit war gleich | |
[pagina 304]
| |
Null. Diese Interesselosigkeit war mir nur angenehm; ich hatte niemandem Rechenschaft abzulegen. Und es bereitete mir stille Befriedigung, dem Großherzog dadurch einen Nimbus zu vermitteln, daß er mir mein Gehalt und meinem Institut eine bescheidene Subvention bezahlte. Wenn ich in den vielen Zeitungsausschnitten blättere, die meine Frau gesammelt hat, so finde ich nichts als widersprechende Kritiken - bald Tadel, bald Lob. Eine gegen das Gift der Verunglimpfung wie der Verhimmelung weniger widerstandsfähige Natur, als ich es bin, wäre aus dem Geleise geworfen worden. ‘Van de Velde ist ein Genie’, behaupteten die übertriebensten Verehrer, andere bezeichneten mich als einen ‘unerbittlichen Denker und Prediger, als einen Ästheten und Poeten’. Zwischen allzuviel Weihrauch und unversöhnlicher Anfeindung konnte ich nichts anderes tun, als auf mich selbst vertrauen und durch ständigen Fortschritt mit meinen Arbeiten die Richtigkeit meiner Prinzipien und die Kraft der ihr innewohnenden Wahrheit beweisen. | |
Kunsttheoretische SchriftenSeitdem ich von Jüngern und Schülern umgeben war, verspürte ich ein Bedürfnis nach Schönheit und reiner Form wie nie zuvor. Ich empfand den dringenden Wunsch, meine Umgebung an meiner Begeisterung und der schöpferischen Kraft teilnehmen zu lassen, aus der heraus meine Werke entstanden. Nachdem Plato und Aristoteles den göttlichen Ursprung der Schönheit erkannt und mehr als zwanzig Jahrhunderte später der deutsche Philosoph Baumgarten die Ästhetik als eine eigene Wissenschaft gefordert hatte, sind Kunst, Vollkommenheit und Schönheit Gegenstand von Spekulationen geworden, die zu einer Verwirrung und Verdunklung der Begriffe geführt haben. Ich suchte leidenschaftlich zu ergründen, was die Gelehrten zu diesen Begriffen zu sagen hatten, und fand bald heraus, welche Ästhetiker des 18. und 19. Jahrhunderts mir als Kronzeugen für meine Theorie der vernunftgemäßen Schönheit dienen konnten. Wer eine Ästhetik unsrer Zeit zu schreiben sich vornimmt, wird sich in die Bücher von Boetticher, Schopen- | |
[pagina *49]
| |
 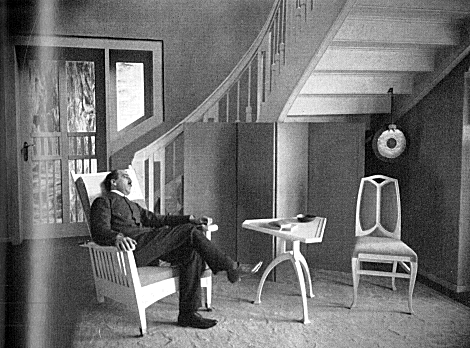 | |
[pagina *50]
| |
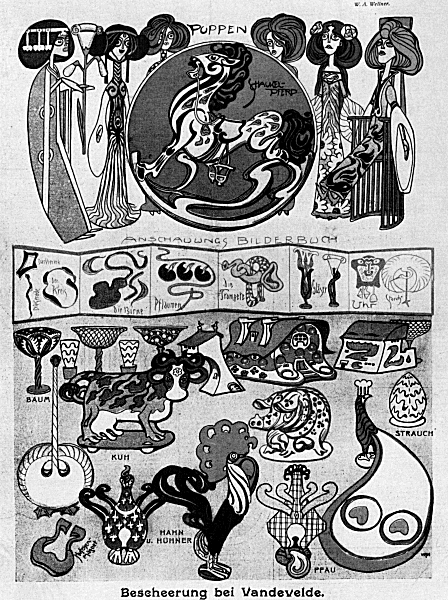
92 ‘Bescherung bei van de Velde’, Karikatur von W.A. Wellner
| |
[pagina 305]
| |
hauer und Fechner und in die ästhetischen Schriften von Theodor Lipps und Paul Souriau vertiefen müssen. Diese haben zur Klärung beigetragen, während viele andere mit ihren Haarspaltereien das Durcheinander nur vermehrt haben. Im Januar 1907 veröffentlichte der Insel-Verlag in Leipzig eine Art Fortsetzung meiner ‘Laienpredigten’ unter dem Titel ‘Vom Neuen Stil’. In der Vorrede wies ich auf den Kontrast zwischen dem schädlichen Einfluß der Sentimentalität und der Rückkehr zum Zauber der Materialien hin. Ich schrieb: ‘Unsere Fähigkeit zur ästhetischen Sensibilität wurde bis an das Ende des 19. Jahrhunderts erstickt. In dem Bereich der Architektur, der Malerei, der Skulptur, der Poesie und der Musik haben wir den Gefühlen alle die höheren und vergeistigteren Empfindungen geopfert, mit denen uns die Sensibilität zu erfreuen vermag. Die Menschheit, die den Genuß an ästhetischer Empfindsamkeit höher stellen wird als den Genuß der Gefühlsempfindungen, wird imstande sein, ein Kunstideal zu erfassen, das Verwandtschaft mit dem griechischen Ideal verspricht.’ Alle in dem Buch ausgedrückten Gedanken - auch was nur indirekt gesagt ist - weisen auf ein einziges Ziel: die Schaffung eines neuen Stils, der allen von der Renaissance abgeleiteten Stilen diametral entgegengesetzt ist. Aus den vielen Kritiken, die über das Buch erschienen sind, greife ich einen Abschnitt aus einem Aufsatz des Schriftstellers Johannes Schlaf heraus, der mir seine Zustimmung ausdrückte: ‘Laienpredigten, Zweiter Teil, betitelt sich ein Zyklus von Abhandlungen, in denen Henry van de Velde für seinen neuen Kunststil eintritt. Dieser zweite Teil, ‘Vom Neuen Stil’, erschien soeben; in einer Ausstattung, versteht sich, die die Freude jedes Bibliophilen und Kunstliebhabers sein muß. Er enthält außer einer kurzen Vorrede vier Aufsätze, die über ‘Die veränderten Grundlagen des Kunstgewerbes seit der Französischen Revolution’ handeln, über ‘Das Streben nach einem Stil, dessen Grundlagen auf vernünftiger, logischer Konzeption beruhen’, über den ‘Neuen Stil’ und eine ‘Gedankenfolge für einen Vortrag’. Das Deutsch des belgischen Meisters ist zwar hie und da stilistisch etwas fremdartig, doch ebenso schlicht wie klar und eindringlich. Der, welcher den rechten Sinn hat für ein so wertvolles menschliches und künstlerisches Dokument und seine individuelle, organische Eigenart, würde gerade dieses ein wenig fremdartige | |
[pagina 306]
| |
Deutsch hier nicht vermissen wollen. Ein Mensch, eine Persönlichkeit, ein fester, rund in sich gefügter und bedeutender Charakter steht vor uns und spricht über das ernsteste, hingebendste, notwendigste Streben seines Lebens. Und was er über den Neuen Stil sagt, ist eine Offenbarung, die lebensvolle und Überzeugende Äußerung eines klar Erkennenden, eines Siegers, eines jener ‘Europäer’, die bereits auf fertigem Neuland stehen.’ Ich habe in dem Band ‘Vom Neuen Stil’ die Beobachtungen und Kenntnisse zusammengefaßt, die mich nach und nach in den Stand setzten, der höchsten Reinheit der Form nahezukommen und sie schließlich faktisch zu realisieren. Daß ich nur langsam zur Vollkommenheit gelangte, dessen war ich mir bewußt, aber es war mir noch nicht klargeworden, daß ich Schritt um Schritt dem höchsten Ziel entgegenging: der Schönheit. Zum Verleger meines Buches ‘Vom Neuen Stil’, Anton Kippenberg, und zu seiner Frau Katharina, die zu meinen eifrigsten Anhängern gehörten, trat ich in enge freundschaftliche Beziehungen, die bis zum Tode der beiden prachtvollen Menschen - Prof. Kippenberg starb 1950 in Luzern - lebendig blieben. Zwischen dem Insel-Verlag und der Weimarer Kunstgewerbeschule war eine fruchtbare Zusammenarbeit entstanden, die vor allem die Werkstätten für Buchschmuck und Buchbinderei sowie mein Privatatelier betraf. Ich lieferte Maquetten, typographische Ornamente und Einbandentwürfe für die ‘Dithyramben’, für die Monumentalausgabe des ‘Zarathustra’ und für ‘Ecce Homo’ von Nietzsche und für ‘Les heures du soir’ von Emile Verhaeren, deren erste französische Ausgabe der Insel-Verlag 1911 herausbrachte. Emile Verhaeren kam bei dieser Gelegenheit nach Deutschland und besuchte uns in Weimar. Meine Zusammenarbeit mit Anton Kippenberg dauerte bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Der Luxusausgabe der ‘Dithyramben’, für die ich das Titelblatt und Textornamente gezeichnet hatte, war ein seltsames Schicksal beschieden. Die auf Pergament gedruckten, in Ganzleder gebundenen Exemplare enthielten handvergoldete Zierleisten. Sie befanden sich 1914, bei Kriegsausbruch, in London bei dem damals besten Spezialisten dieser Technik des Handvergoldens. Die drei oder vier Dutzend Bände wurden von englischer Seite sequestriert und zwangsversteigert. Als Anton Kippenberg nach dem Krieg wieder nach London kam, erfuhr er von dem Vergolder, daß sie als ‘feindliches Gut’ betrachtet worden waren. | |
[pagina 307]
| |
Nach vielem Nachforschen wurden die Exemplare in dem Keller eines Trödlers in der City gefunden. Durch die Feuchtigkeit, der sie während der Jahre ausgesetzt waren, hatten die Bände großen Schaden erlitten. Kippenberg schenkte mir eines der am besten erhaltenen Exemplare. Mit meinem Buch ‘Vom Neuen Stil’ sind Erinnerungen an mehrere Aufenthalte in Schwarzburg und an den Prinzen Günther zu Schwarzburg-Rudolstadt und seine Gattin Prinzessin Luise verbunden. Aus dem Bedürfnis nach Ruhe suchte ich gelegentlich das Hotel ‘Weißer Hirsch’ in Schwarzburg auf. Nicht weit davon lag die alte Burg, in der das Prinzenpaar einen großen Teil des Jahres verbrachte. Durch einen Herrn des Hofes erhielt ich eine Einladung zum Besuch der Prinzessin. Der Prinz empfing mich allein, ein großer, kräftiger Mann von etwa fünfzig Jahren. Er entschuldigte sich, daß er mir so formlos unter Verzicht auf alle Etikette gegenübertrat, daß er ein Jagdgewand mit Pelzweste und kurzer Lederhose trug und daß er nur wenige Augenblicke Zeit habe, da er im Begriffe sei, wie allabendlich auf den Anstand zu gehen. Im Gespräch mit der Prinzessin, die mich nach den Gründen fragte, die mich in diese einsame, vom mondänen Leben so ferne Gegend führten, war bald fast nur noch von der Anziehungskraft die Rede, die der Wald, der Thüringer Wald mit seinen romantischen und historischen Erinnerungen auf mich ausübte: die Wartburg, die Gestalten der Tannhäusersage, der Venusberg, Eisenach, Johann Sebastian Bach. Die Prinzessin erbot sich, mir die schönsten Teile dieser Region, zu der ich mich hingezogen fühlte, zu zeigen. Ich stimmte gerne zu und verhehlte nicht, wie glücklich ich über das Zusammensein mit dieser ernsten, reizvollen, selbstbewußten und doch so weiblichen Frau war. Ich hatte sie einige Male von der Terrasse des Hotels aus den steilen Abhang herabreiten sehen und ihre kühne Haltung beobachtet. Bei unseren Ausflügen in einem mit vier weißen Arabern bespannten Break bewunderte ich die Virtuosität und den Mut, mit denen sie das Gefährt lenkte. Die hinter uns stehenden Lakaien waren stets auf dem Sprung, die Pferde anzuhalten und uns aus dem Graben zu ziehen, in den sie uns schon stürzen sahen. Ich begriff die Leidenschaft der Prinzessin, sich ihrer eigenen Kräfte bewußt zu werden. Zugleich ihre Leidenschaft für den Reitsport und ihre geradezu mystische Neigung für die Geheimnisse des Waldes, in dessen Schutz sie sich geborgen fühlte. | |
[pagina 308]
| |
Oft haben wir, wenn wir an besonders schönen, feierlichen Orten die Fahrt unterbrachen, unsere Eindrücke ausgetauscht. Ich versuchte in Worte zu fassen, was der Wald für mich bedeutete: Eine Masse von siegreichen Riesen, einer mächtiger und stolzer als der andere; hohe Rotbuchen, Lärchen, die ihre Zweige wie Spitzengewänder ausbreiten, Birken mit ihrer Rinde aus poliertem Leder und Silber. Den Stürmen halten sie stand, den Gefahren trotzen sie, ohne einen Zoll des Platzes preiszugeben, auf den sie gestellt worden sind. Der Wald, das lebendige Bild und Beispiel dessen, was Dauer bedeutet, eines der großen Schauspiele und eine der mächtigen Lehren, welche die Natur dem Menschen darbietet. Er ist die Verkörperung ergreifender Harmonie und feierlichen Gleichgewichtes unzähliger Kräfte, ähnlich den Kräften, die vom Firmament auf uns herniederstrahlen. Der Wald erweckt in uns das Gefühl einer unaussprechlichen Ruhe. Ein heiliger Ort - der einzige, der keine Erniedrigung oder Unterwerfung von dem verlangt, der ihn zu seinem Trost aufsucht. Ungebeugt und gleich zu gleich betritt der Mensch dieses wunderbare Reich der Natur. Mit der Zeit bekehrte ich den Prinzen und die Prinzessin zu meinen künstlerischen Überzeugungen. Sie erfüllten einen meiner tiefsten Wünsche: einen Winkel zu haben, wohin ich mich zurückziehen konnte, einen Ort, den niemand - nicht einmal meine Frau - kennen sollte, wo ich ein neues Buch vorbereiten konnte, das der Insel-Verlag so bald wie möglich publizieren wollte: eine Folge von ‘Essays’ als Ergänzung zu meinen bisherigen Vorträgen; Darlegungen, die meine Doktrin auf solide Grundlagen stellen sollten. Und vom Frühjahr des folgenden Jahres an logierte ich nicht mehr im Schwarzburger ‘Weißen Hirsch’, sondern im Haus eines fürstlichen Försters, das, völlig verborgen, in einer der verlassensten Gegenden des Waldes gelegen war. Dort vertiefte ich mich im Laufe der Jahre 1908 und 1909 in die Studien für die Abfassung der Kapitel ‘Die Belebung des Stoffes als Prinzip der Schönheit’, ‘Die Linie’ und ‘Die vernunftsgemäße Schönheit’, die 1910 in dem Band ‘Essays’ herauskamen. Seit Beginn der Renaissance des Kunstgewerbes und der Architektur suchte ich klarzumachen, daß diese Wiedergeburt nur dann zum Ziel gelangen könne, wenn wir entschlossen die Idee der Schaffung eines ‘neuen | |
[pagina 309]
| |
Stils’ verfolgten. Von Anfang an hat man uns vorgeworfen, daß wir die Prinzipien eines Stils zu formulieren und seine Kennzeichen zu umschreiben versuchten, noch ehe er tatsächlich existierte; daß wir künstlich hervorrufen wollten, was bisher stets ohne vorbedachte Überlegung entstanden war. Dieser Vorwurf wäre nicht erhoben worden, wenn wir, statt die Herrschaft vernunftgemäßer Gestaltungsprinzipien zu proklamieren, irgendwelche neuen, sensationellen und frivolen Formen propagiert hätten. Unser Kampf für ein Ideal, das die Vernunft wieder in ihre Rechte einsetzte, war zu ernst und deshalb wenig geeignet, ein Publikum zu überzeugen, das ganz auf das Momentane, das Wechselnde eingestellt und für das Dauernde, Ewige, das heißt für ‘Stil’ nicht interessiert war. Ich konnte wohl auf die Meinung der großen Begründer modernen Geistes hinweisen. Auf Michelangelos Wort ‘Das Schöne beruht auf der Reinigung von allem Überflüssigen’ oder auf Leonardos Klage ‘Weshalb können Schönheit und Zweck nicht zusammen bestehen, so wie es in der Architektur und im menschlichen Körper in Erscheinung tritt?’. Goethe hat sich noch deutlicher über die Beziehungen von Schönheit und Zweck ausgesprochen, als er während seiner Italienreise erkannte, daß die Notwendigkeit das fundamentale Prinzip der Schönheit der antiken Architektur ausmacht. Wir erklärten: die höchste schöpferische Kraft der Natur ist unveränderlich und ewig, weil sie auf der allmächtigen Intelligenz beruht, die unfehlbar alle Ziele kennt, die sich in den Schauspielen der Natur offenbart, in den Bäumen, den Blumen und in den belebten Wesen. Die Erkenntnis, daß Zweck und Schönheit eins sind, daß sie sich verschmelzen und daß die Schönheit dessen, was wir ‘Gottes Werk’ nennen, dem Elementarprinzip der Vernunft entspringt, entpuppte sich als eine der fruchtbarsten Wahrheiten. Wenn Gott sich dieses Prinzips bedient hat, um seinen Schöpfungen Schönheit und Leben zu verleihen, so kann der Mensch nichts Besseres tun, als eben dieses Prinzip auf alles anzuwenden, was zu schaffen er berufen ist. So schafft er nach Gottes Vorbild. In Epochen, in denen auf dieser Grundlage geschaffen wurde, gab es keine Häßlichkeit. Alle Gegenstände, Werkzeuge und Waffen aus prähistorischer Zeit bestätigen diese Theorie und lassen erkennen, daß die von den primitiven Völkern sinnvoll und zweckentsprechend geschaffenen Formen unsere Bewunderung erregen, während sie durch naturalistische Konzeption unschön werden. | |
[pagina 310]
| |
Unter dem Eindruck dieser Erkenntnisse, die mich deshalb so stark berührten, weil sie mir ausschließlich durch Nachdenken - nicht durch Wissen - zum Bewußtsein kamen, habe ich ‘Amo’ geschrieben. Der Hymnus ist das Resultat einer unerwarteten Offenbarung, eines naiven und glühenden Glaubens. Wäre ich den ausgetretenen Bahnen des Wissens gefolgt, so hätte mich niemals das tiefe, feierliche Staunen überwältigt. Im Rahmen eines von Studenten veranstalteten Vortrags las ich zum ersten Male den Hymnus an die vernunftgemäße Schönheit vor. Meine Freunde gerieten von Abschnitt zu Abschnitt in wachsende Bestürzung, und nur mein enthusiastischer Elan, der Ernst und die Liebe, die aus meinen Worten sprachen, verhinderten, daß meine Zuhörer in Lachen ausbrachen. Ich habe ‘Amo’ in jenem Augenblick geschrieben, in dem mein Glauben von höchster Frische war und eine neue Klarheit meinen Geist und mein Herz ergriffen hatte. Der Insel-Verlag gab ‘Amo’ als eines der ersten Bändchen in der billigen Serie der ‘Insel-Bücherei’ heraus, die bei den deutschen Lesern einen großen Erfolg hatte. Mein gleichfalls im Insel-Verlag 1910 erschienener Band ‘Essays’ fand ein ebenso starkes Echo wie das Buch ‘Vom Neuen Stil’. Das ‘Presto’ des Lebenstempos, zu dem ich durch den wachsenden Erfolg meiner Tätigkeit getrieben wurde, ließ mir wenig Zeit zur Muße. In vielen künstlerischen Vereinigungen und Museen hielt ich Vorträge und stellte mich in den Dienst der kunsterzieherischen Bewegung. Die Museen veranstalteten Vorlesungen und Kurse, um das Niveau der künstlerischen Kultur zu heben. Allgemeine kulturelle Probleme beschäftigten die Intelligenz aller zivilisierten Länder. In Deutschland rief das Interesse für unsre Arbeit in Weimar eine gewisse Unruhe hervor, und andere künstlerische Zentren fühlten sich bedroht oder gar schon überrundet. Man stellte die Frage, ob Deutschland, das auf allen Gebieten nach Hegemonie strebte, auf kulturellem Feld von den nachbarlichen Kulturen überrundet sei: von Frankreich, England oder den skandinavischen Ländern. Eines der wichtigsten und meistgelesenen deutschen Blätter, die ‘Frankfurter Zeitung’, griff das Problem auf und stellte einer Reihe bekannter Persönlichkeiten die Frage: ‘Durch welche politischen Mittel kann die kulturelle Entwicklung beschleunigt werden?’ In meiner Antwort, die ich mit ein paar wissenschaftlichen Bemerkungen einleitete, konnte ich eine gewisse Skepsis | |
[pagina 311]
| |
nicht verhehlen, weil ich tief überzeugt war, daß die bekannten Mittel - Volksbibliotheken, Führungen in Museen, Volkskonzerte und Vorstellungen mit freiem Eintritt - nur auf lange Sicht zu einer Besserung führen konnten und daß jeder ‘politische’, das heißt künstliche, Eingriff mehr Gefahr als Nutzen für eine normale Entwicklung der Kultur mit sich bringt. Durch solche Eingriffe wird sie der Gefahr ausgesetzt, ihr natürliches, ursprüngliches Wesen zu verlieren. Die Umfrage der Zeitung verriet die gefährliche, in deutschen intellektuellen Kreisen herrschende Ungeduld, eine ebenso fortgeschrittene Kultur zu besitzen, wie sie in den Nachbarländern in langsamem Reifeprozeß entstanden war. In Deutschland war man nur zu geneigt, das Reifen der Dinge durch die Methode des Treibhauses zu beschleunigen. Mir kam die Idee paradox vor, die Kultur der Politik auszuliefern. Der Vorschlag, den ich machte, mußte nicht weniger paradox, ja absurd erscheinen. Ich bildete mir nicht ein, daß er ernst genommen würde, es war ein Scherz, aber ein Scherz mit ernstem Hintergrund: eine Pferdekur. ‘Wer’ - so schrieb ich - ‘hätte die Beobachtung noch nicht gemacht, daß jeder von uns, auf welcher Höhe der sozialen Stufenleiter er auch stehen mag, einen oder den anderen geringeren Beruf weit besser ausfüllen könnte als den, welchen er bis jetzt innehatte? In vielen Fällen zeigen sich sogar ausgesprochene Vorlieben; wie viele unter den Höchstgestellten haben sich nicht schon mit Leidenschaft einem einfachen Handwerk gewidmet und es zur Vollkommenheit darin gebracht! Wenn nun alle, durch die ganzen Reihen der Gesellschaftsklassen, mit einem Schlag, freiwillig oder gezwungen, eine oder mehrere Stufen zurückrückten, so würde, durch diese allgemeine und plötzliche Verschiebung, die rückständige Kultur eingedämmt und angesammelt, plötzlich steigen wie das Wasser in den Schleusen. Ein jeder brächte in die mindere Stellung, zur Ausführung der minderen Beschäftigung die Talente, den Charakter, die Manieren mit, die er aus einer höheren Lebensstellung bezogen hat, in welcher er sich als nicht ausreichend erwiesen, und er würde unter seinen neuen Lebensbedingungen als das gelten, was eine hochkultivierte Gesellschaft von jedem Individuum erwarten kann. Auf diese Weise hätten wir durch Zauberei oder infolge eines noch nie dagewesenen Vorgangs in der Weltgeschichte Maurer, Tischler, Typographen mit dem Talent und dem Geschmack von Künstlern, Bauern und Arbeiter mit der Initiative und den Manieren der “grands seigneurs”!’ | |
[pagina 312-313]
| |

93 Zweiseitiges Titelblatt zu Nietzsches ‘Ecce Homo’, Insel-Verlag, Leipzig 1908
| |
[pagina 314]
| |
Nicht alle Paradoxe sind nur Spielereien des Geistes oder ephemere Späße. Manche enthalten Keime, die unter günstigen Bedingungen Wurzel schlagen können. Sollte die von mir ausgesprochene Idee von dieser Art sein? Staatsminister Rothe fragte mich bei einer Gesellschaft im Nietzsche-Archiv, welche Hintergedanken mich wohl zu solchen Ideen gebracht hätten. Er witterte richtig, daß die Verhältnisse im Großherzogtum meinen grotesken Einfall hatten entstehen lassen, denn er erkundigte sich schließlich, wie ich mir die Anwendung meines Heilmittels in Weimar vorstellen würde. Offenbar habe ich ihm dann ein recht düsteres Bild der neuen Hierarchie gegeben, denn er wich mit einem so brüsken Schritt zurück, daß ich meine Hand nach seiner Teetasse ausstreckte, die ihm zu entgleiten drohte. Er wandte sich rasch Frau Förster-Nietzsche zu, die ihn nur mit Mühe beruhigen konnte. Sie führte ihn zu mir zurück, und ich entschuldigte mich, nicht bemerkt zu haben, daß Seine Exzellenz ernst genommen hätte, was doch nur ein Scherz gewesen sei. Und unsre Freundin bat ich um Verzeihung, daß sie einen Augenblick hatte befürchten müssen, ich könnte mich mit dem Staatsminister entzweien, auf dessen Unterstützung wir angewiesen waren. | |
Das Abbe-Denkmal in JenaNach dem Tode Ernst Abbes beschlossen die Angestellten und Arbeiter der Carl-Zeiss-Werke in Jena, zur Erinnerung an das Werk und an die Uneigennützigkeit ihres Leiters ein Denkmal zu errichten. Abbe, dessen Familie französischen Ursprungs war, verwirklichte ein fortschrittliches betriebswirtschaftliches System, das großzügiger, weniger theoretisch und menschlicher war als die abstrakteren, von Marx und Engels vertretenen Prinzipien. Er errichtete eine Stiftung, die die Verteilung des Betriebsgewinnes in dem Sinne vorsah, daß ein Teil den Arbeitern zur Verbesserung ihrer materiellen Lage zufloß, während der andere Teil zur Unterstützung kultureller Institutionen, der Universität Jena und unter anderem für eine Volksbibliothek und ein Volkshaus bestimmt wurde. Diese Bestimmungen hoben mit einem Schlag die Würde der Arbeiter, die sich nunmehr unmittelbar mit den kulturellen Einrichtungen verbunden | |
[pagina 315]
| |
fühlten, die ihnen bisher fremd gewesen waren. Ihre Arbeit wurde geadelt. Sie hatten mehr als eine Existenzverbesserung erhalten. Es hatte eine gewisse Gleichstellung mit den Gelehrten und mit den leitenden Persönlichkeiten stattgefunden, mit denen sie in eine Gemeinschaft eingetreten waren. Hier wurde ein sichtbarer Beitrag zur Kultur geleistet. Ein Fortschritt und Perspektiven, die wirksamer und realer waren, als es mein boshaftes Paradoxon angedeutet hatte. Zur Errichtung des Denkmals wurde ein Wettbewerb unter nur wenigen Künstlern ausgeschrieben, an dem sich die berühmtesten Bildhauer Deutschlands beteiligten. Keiner der abgegebenen Entwürfe befriedigte die Wettbewerbskommission, und keiner der Bildhauer wurde aufgefordert, ein neues Modell vorzulegen. Die Kommission zögerte und sah keinen Ausweg. Eine Gruppe von Arbeitern beriet sich und beschloß, unabhängig von den anderen Mitgliedern der Kommission, statt einem Bildhauer den Auftrag für das Denkmal einem Architekten zu übertragen, der die vier Reliefs, die Constantin Meunier für ein ‘Monument der Arbeit’ geschaffen hatte, seinem Entwurf einfügen sollte. Eine Delegation der Arbeiter erschien unerwartet bei mir in Weimar, um sich über Meuniers Reliefs zu erkundigen. Die dreitausend Arbeiter und Angestellten von Zeiss waren der Meinung, mit den Reliefs Meuniers könne das Andenken Abbes am würdigsten gefeiert werden. Der Zufall wollte es, daß ich zwei Jahre vor Meuniers Tod (1905) dem Meister Modell für eine Büste saß, die zu einer Serie von Porträts belgischer Persönlichkeiten - Emile Verhaeren, Camille Lemonnier, Georges Eckoudt, Emile Vandervelde, Jules Destrée und Théo van Rysselberghe - gehörte. Während dieser Sitzungen erzählte mir Meunier, daß er sich vor Jahren schon wegen des architektonischen Aufbaus des ‘Monumentes der Arbeit’ an Victor Horta gewendet hätte. Horta hatte ein Modell ausgeführt. Die vier Reliefs sollten in einen von der großen Figur des Sämannes beherrschten Kubus eingelassen werden, an dessen vier Kanten weitere Skulpturen Meuniers vorgesehen waren. Dieses anspruchslose Modell, das eine gewisse innere Größe und Monumentalität besaß, wurde nicht ausgeführt. Spätere Entwürfe, die aus der Zusammenarbeit Meuniers mit Horta hervorgingen, wurden immer weniger gut und führten schließlich zu einem Projekt, das von einem virtuosen Konditor hätte ausgedacht sein können. | |
[pagina 316]
| |
Da ich mit der Familie Meunier gut befreundet war, konnte ich meinen Besuchern Hinweise geben, auf welche Weise sie die Reliefs erhalten konnten. Sie wiederum baten mich, ihnen kostenlos einige Vorschläge zu machen, Skizzen oder Modelle für das Denkmal, für das ein Platz mitten in der Fabrik unmittelbar neben dem bescheidenen Haus Abbes vorgesehen war. Ich erklärte, nichts unternehmen zu können, ehe ich nicht meine Freunde in Jena gesprochen hätte, die mir über den Stand der Dinge, das hießt über etwaige Verpflichtungen gegenüber den Bildhauern, die am Wettbewerb teilgenommen hatten, Auskunft geben konnten. Die Delegation betonte noch einmal, daß die ganze Arbeiterschaft der Zeiss-Werke hinter ihr stehe, und verließ mich offensichtlich befriedigt. Die maßgebende Kommission schloß sich der Auffassung der Arbeiter an und übertrug mir den Auftrag. Mein Modell entsprach dem, was sie sich vorstellte. ‘Die Arbeiterschaft hat diesmal einen feinen Instinkt gehabt’, schrieb der bekannte Kunstkritiker Joseph August Lux. Eine Gruppe süddeutscher Künstler protestierte wie üblich unter Hinweis auf mein Ausländertum. Lux erwiderte: ‘Einem im Ausland geborenen Künstler dürfte die Aufgabe nicht zufallen? Künstlerisch, nicht wahr? Was hat die Sache Abbes mit dem nationalen Standpunkt zu tun? Was hat die Kunst damit zu tun? Und vor allem: lebt dieser Künstler nicht in Deutschland? Hat er seine Kraft nicht unserer Sache gewidmet? Beruht ein guter Teil neuer deutscher Kunst nicht auf fremdem Import?’ Botho Graef, der leidenschaftliche Wortführer der Jenaer Intellektuellen - alle wie er Universitätsprofessoren -, schrieb in der Berliner Zeitschrift ‘Kunst und Künstler’ (1912) einen Aufsatz über den ‘Abbe-Tempel’. Er analysierte die Elemente, aus denen sich das Werk zusammensetzt, mit der gleichen Genauigkeit, mit der er als Kunstgeschichtsprofessor seinen Studenten irgendeinen Bau der Antike oder irgendeines anderen historischen Stils erklärte. Graef war zeitbewußter als die übrigen Professoren, die ängstlich in den konventionellen Grenzen ihres Fachgebietes verharrten. Er führte seine Studenten in die Werke von Degas, Toulouse-Lautrec, Munch ein und machte sie mit dem Schaffen der Expressionisten bekannt, unter denen er das Haupt der Malergruppe ‘Die Brücke’, E.L. Kirchner, besonders hervorhob. Durch die Einbeziehung der modernen Kunst schlug Graef einen Bogen über die Kluft der Zeiten und eröffnete der kunsthistorischen Betrach- | |
[pagina 317]
| |
tung Perspektiven, die bis zu den ältesten Zeugen der Kunst reichten: zu den Bildern und Ritzzeichnungen der Steinzeit, den kretischen Fresken, zu den ägyptischen Gräbern und den Reliefs der Mastabas. Er zählte mein Jenaer ‘Sanktuarium’ zur Familie der Tempel und bestätigte damit mein Streben, auf dem Weg über die Disziplin der vernunftgemäßen Konzeption an die wahre klassische Tradition der Architektur anzuknüpfen. In den vom Atem der Natur belebten, nach klassischen Gesetzen rhythmisierten steinernen Formen meines modernen Tempels spürte er die Verwandtschaft mit attischer Kunst. ‘Als Material’ - schrieb Graef - ‘war das Thema Stein und Erz gegeben, und jedermann weiß, wie erfinderisch gerade van de Velde wird, wenn es sich darum handelt, den künstlerischen Gehalt des Materials zum Leben zu wecken. Die Steine sind aufeinandergetürmt, fast wie bei Bauwerken früher oder primitiver Zeiten, sie wollen nicht Pfeiler oder sonst durch andere Kunstperioden ausgebildete bekannte Bauglieder formen, sondern bilden wie von selbst die schweren, aus drei Blöcken bestehenden Türpfosten mit der eigentümlichen Schwellung in der Mitte. Die geraden Wände dazwischen stehen auf einem Sockel, der dem Grundriß entsprechend gebogen ist und in wundervollem konkavem Schwung aus dem Boden aufsteigt. Die Wand ist durch flache Pilaster belebt, die sich oben in schlanken Spitzbogen verbinden, eine unmittelbare, aus dem Steinschnitt sich ergebende Gliederung. Die grundsätzlich verschiedene Behandlung von Tür und Wand - denn zu den Türen führen allein die Stufen hinauf - wird durch das weitausladende Gesims über den Türen fortgeführt, dem am meisten in die Augen fallenden Kennzeichen des Bauwerks. Sie sind ein Ausdruck des fast bis zur Kampfeslust gesteigerten Schaffensdrangs des Künstlers. Darüber liegt die kupfergedeckte Flachkuppel, kupfern sind die Türen, sparsam mit einem Ornament versehen, das die Schrauben für die Befestigung des Beschlages birgt. Die Türflügel können sich ganz in die Laibung hineinlegen und lassen so den Bau bei geschlossenen wie bei geöffneten Türen gleich vollkommen erscheinen.’ Im zweiten Teil seines Aufsatzes erklärte Graef die ungewöhnliche Form, die Max Klinger der in der Mitte des Tempels stehenden Büste Abbes gegeben hat: ‘Für das heroisierte Bildnis eines großen Mannes war Klinger der durch eine Reihe starker Schöpfungen erprobte Meister; sein Liszt und sein Nietzsche sind Köpfe in dem Sinne geschaffen wie die bedeutenden Por- | |
[pagina 318]
| |
träts, die in der griechischen Kunst nach Alexander entstanden sind. Sie nehmen die überlieferten Züge nur als eine Grundlage, um das geistige Wesen eindringlich und eindeutig darzustellen, im Geiste hier den Griechen verwandt, in der Form aus Klingers eigener, durch die moderne Entwicklung der Plastik gereifter Auffassung entstanden.’ Ich hätte eine Hermesbüste dem Porträt Abbes vorgezogen. Über den kubischen Sockel mit Flachreliefs auf drei Seiten ärgerte ich mich. Sein Volumen wirkt in der Mitte des Raumes erdrückend, und die weichliche, etwas unechte Grazie der Flachreliefs ordnet sich weder dem Rhythmus noch der mächtigen Männlichkeit des linearen Aufbaus der großen Reliefs Constantin Meuniers ein.
Nach Harry Kesslers Verabschiedung war ein lebhafter Briefwechsel zwischen ihm und mir entstanden. Er wollte über den Lauf der Dinge orientiert sein und fürchtete, daß man auch mich beseitigen würde, dessen Anwesenheit in Weimar am Berliner Hof mißbilligt wurde, weil man mich als Rebell gegen den Kaiser betrachtete. Jedes Lob, jede günstige Kritik, jeder Erfolg, den ich errang, erregte in Berlin unangenehmes Aufsehen; das Zögern des Großherzogs mir gegenüber wurde heftig kritisiert. Zu dieser Zeit (um 1906) erwarb eine Gruppe deutscher Kunstmäzene die ‘Villa Romana’ in Florenz, um es Künstlern zu ermöglichen, ein oder mehrere Jahre frei von materiellen Sorgen als Stipendiaten zu leben und zu schaffen. Max Klinger war der Initiator dieser Idee und Präsident der Kommission, die die Preisträger bestimmte. Als erste waren fünf Künstler bestimmt worden, die alle den modernen Strömungen angehörten. Ich befand mich unter ihnen. Die Presse ganz Deutschlands schrieb über die Gründung der neuen Institution und über die Wahl der Stipendiaten. Es gab neuen Lärm. Im Lager der offiziellen Künstler wirkte die Entscheidung wie ein Wespenstich oder wie ein Schlangenbiß. Kein Wunder: mit mir waren die beiden bissigsten Karikaturisten des Münchner ‘Simplizissimus’, Thomas Theodor Heine und Olaf Gulbransson, nach Florenz eingeladen worden! Harry empfahl mir dringend, die Einladung anzunehmen und mir wenigstens ein paar Monate Sammlung und Erholung zu gönnen. Aber ich konnte Weimar nicht für längere Zeit verlassen. Die Kunstgewerbeschule und die | |
[pagina 319]
| |
Einrichtung meines Hauses ‘Hohe Pappeln’ erforderten meine Anwesenheit. Ein Urlaubsgesuch wäre zweifellos bereitwillig genehmigt worden. Aber nach meiner Rückkehr hätte ich einen anderen Direktor der Kunstgewerbeschule vorgefunden! Der Posten war zu begehrt. Außerdem hatte Professor Koetschau, der zum Nachfolger Graf Kesslers ernannt worden war - er war Assistent am Berliner Kaiser-Friedrich-Museum gewesen -, vor kurzem sein Amt in Weimar angetreten. Er hatte das Angebot der Regierung unter der ausdrücklichen Bedingung angenommen, daß der längst fällige Museumsneubau verwirklicht würde. Vom Beginn seiner Tätigkeit in Weimar an zeigte Koetschau lebhaftestes Interesse für das Seminar, meine Schule, für meine Ziele und meinen Kampf. Er wurde mit großer Sympathie von unserem Kreis aufgenommen. Seine Verläßlichkeit, seine gerechte und objektive Art und seine natürliche Autorität, die auch von den deutschen Museumsfachleuten besonders geschätzt wurden, öffneten ihm und seiner Frau den Zugang zu allen Zirkeln, die trotz aller Machenschaften des Hofes die Fahne des ‘neuen Weimar’ hochhielten. Bei seinen ersten Besprechungen mit der Regierung hatte Koetschau abgemacht, daß die Ausführung der Pläne für das neue Museum mir übertragen würde. Aber die Regierung verlegte sich auf Verzögerungsmanöver, mahnte zur Geduld und behauptete, beim Großherzog einen günstigen Moment abwarten zu wollen. Koetschau ließ sich nicht zu lange vertrösten. Er traute den vagen Versprechungen nicht mehr, die ihm von seiten der Regierung und des Hofes gemacht wurden, und nahm ein Angebot an, am Berliner Kaiser-Friedrich-Museum eine leitende Stellung zu übernehmen. Auch die Achtung und die freundschaftliche Zuneigung, die ihm von unserem Kreis entgegengebracht wurden, konnten ihn nicht in Weimar halten. Wegen eines schweren Trauerfalles übersiedelte er plötzlich nach Berlin. Sein Weggang wurde von allen, die ihn gekannt hatten, sehr bedauert. Nur eine Spur blieb von ihm zurück: ein Erbbegräbnis auf dem Weimarer Friedhof, das ich auf seinen Wunsch errichtet habe und wo er selbst einst neben seinen Eltern bestattet sein wollte. | |
[pagina 320]
| |
WerkbundMeine Gedanken über die Zusammenarbeit von Kunst, Kunsthandwerk und Industrie, die in meinem Vertrag mit dem Großherzog von Sachsen-Weimar ausdrücklich festgelegt waren, begannen sich zu verbreiten. Außerhalb der Grenzen des Großherzogtums zunächst in Sachsen und Bayern. Der Erfolg meiner Wanderausstellung hatte eine Reihe von Industriellen dieser Länder beeindruckt, die mit Münchner Künstlern in Verbindung standen. An der Spitze dieser Industriellen stand Hofrat Peter Bruckmann, an der Spitze der Künstler die Münchner Architekten Theodor Fischer und Richard Riemerschmid, der von der Malerei zur Architektur und zum Kunstgewerbe hinübergewechselt hatte. In einigen Kreisen sah man und sieht man heute noch in mir den geistigen Vater des Werkbundes. Die wirklichen Gründer sind aber die Männer des Münchner Kreises. Ihre Initiative führte zu einer Versammlung von mehreren hundert Künstlern, Kunsthandwerkern, Architekten und Industriellen, die im Oktober 1907 in München stattfand. Hieraus ist der Werkbund hervorgegangen, der im Juli 1908 zum ersten Male offiziell zusammentrat. Trotzdem darf man sagen, daß die Werkbundidee in ihren wesentlichen Elementen auf das Programm meines Weimarer Seminars zurückgeht und auf die Art der Funktionen, die ich in der kunsthandwerklichen und kunstindustriellen Produktion des Großherzogtums ausübte. Der Werkbund faßte alle lebendigen Kräfte und moralischen Impulse zusammen, deren Verwirklichung ich seit 1902 meine intensivsten Kräfte gewidmet habe. In den ersten Werkbundsatzungen finden sich folgende Worte: ‘Die Veredelung der gewerblichen Arbeit im Zusammenwirken von Kunst, Industrie und Handwerk.’ ‘Die Hebung des künstlerischen Niveaus der Erzeugnisse der Handwerker und Kunstindustrien’ hieß es im Vertrag, den ich mit dem Großherzog von Sachsen-Weimar abgeschlossen hatte. Sind diese Definitionen nicht identisch? Und wäre die Folgerung anmaßend, daß meine Weimarer Tätigkeit und die Gründung des ‘Kunstgewerblichen Seminars’ die Wurzel und die erste Knospe dessen bedeuteten, was sich im Werkbund entwickelte? Anläßlich der zweiten Jahresversammlung des Deutschen Werkbundes, die vom 30. September bis zum 2. Oktober 1909 in | |
[pagina *51]
| |
 | |
[pagina *52]
| |
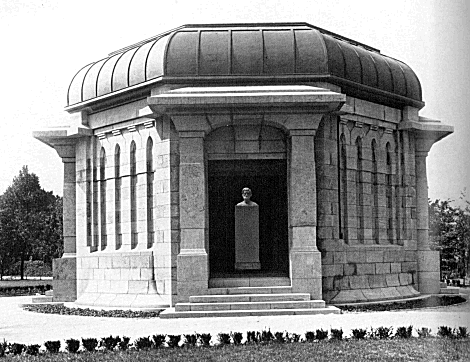
95 Abbe-Denkmal in Jena, 1908/11
| |
[pagina 321]
| |
Frankfurt stattfand, wurde ich zu einem Vortrag aufgefordert, für den ich als Thema wählte ‘Kunst und Industrie’; der Wortlaut ist in meinem Buch ‘Essays’ erschienen. Es handelte sich vor allem darum, die Mißverständnisse zwischen den Künstlern und Industriellen zu beseitigen. Auf beiden Seiten herrschten Mißtrauen und Vorurteile von fast krankhafter Art. Der Vortrag bedeutete für mich eine heikle Aufgabe, bei der ich nur zu leicht zwischen Hammer und Amboß geraten konnte. Ich versuchte, die Notwendigkeit der Zusammenarbeit auf einem Gebiet der wirtschaftlichen Wirklichkeit aufzuzeigen, auf dem seit der Erfindung der Maschinen Fabriken entstanden waren, deren Erzeugnisse infolge der Ahnungslosigkeit der Fabrikanten die Welt mit häßlichen Dingen überschwemmten. Es war schwer, ja vielleicht unmöglich, die Künstler dazu zu bringen, die Schuld der Industrie zu vergessen, schwer, sie von ihrer Abneigung abzubringen. Andrerseits bestand die Gefahr, daß die Industriellen, die bereit waren, auf die in ihren Produktionsmethoden liegende Immoralität zu verzichten, befürchteten, die Mitarbeit von Künstlern werde den Gewinn schmälern, auf dem die Existenz der Industrie aufgebaut war. Ein künstlerisches Ideal mit dem Gewinndenken zu versöhnen, hieß das nicht, Feuer mit Wasser vermischen zu wollen? Ich wagte den Versuch, weil ich überzeugt war, daß gerade und nur durch die Mitarbeit der Künstler der Mißkredit beseitigt werden könne, dem die Produkte der Kunstindustrien ausgesetzt waren. Meine Darlegungen wirkten auf die im Werkbund versammelten Künstler überzeugend. Und auch die Industriellen verstanden, daß eine geschickt gelenkte Propaganda, die die Mitarbeit der Künstler hervorhob, den Publikumsgeschmack in starkem Maß anreizen konnte. Die Ergebnisse waren rasch zu bemerken. Die Modelle mit dem Schild ‘Entwurf Professor Soundso’ erregten wachsendes Aufsehen, und die Verkaufserfolge steigerten sich außerordentlich. In allen deutschen Haushaltungen standen die ‘Professoren’ hoch im Kurs; sie wurden mit Aufträgen überhäuft. Bei sorgfältiger Überlegung wäre für sie - und für mich mit ihnen - etwas mehr Zurückhaltung richtiger gewesen. Das Renommee, Professor zu sein, bekam nach und nach einen wenig appetitlichen Beigeschmack. |
|

