Geschichte meines Lebens
(1962)–Henry Van de Velde–
[pagina 32]
| |
Drittes kapitel
| |
[pagina 33]
| |
des Frühlings zeigten. Ein rauher Landstrich, bescheidene, niedere, strohbedeckte Bauernhöfe, die durch tief ausgefahrene Sandwege mit alten Birken verbunden waren. Endlose, von dichtem, ockerfarbigem Heidekraut bedeckte Ebenen. Da und dort eine in der Unendlichkeit verlorene Schafherde. Über den hohen Himmel glitten die ersten Frühlingswolken, vom Gold der zarten und noch kühlen Sonne umsäumt. Crabeels und Rosseels empfingen uns freundlich. Heymans war von einem längeren Winteraufenthalt in Brüssel noch nicht zurückgekehrt. Seit unsrer Ankunft in Wechel der Zande hatte ich das Gefühl, hier ein Leben verwirklichen zu können, wie es mir in Barbizon nach dem Beispiel Jean-François Millets vorgeschwebt hatte. Ich hatte das leerstehende ‘Atelier’ gesehen. Der Pensionspreis war so bescheiden, daß ich nicht an der Zustimmung meiner Eltern zweifelte. Und schon beim Abendessen am zweiten Tag teilte ich meinen Kameraden meinen Entschluß mit, in diesem Dorf zu bleiben. Sie wollten mich davon abbringen und baten mich dringend, zu bedenken, welche Widerstandskraft ein so einsames Leben unter so unsicheren materiellen Bedingungen von mir verlangte. Meine Hartnäckigkeit war ihnen unverständlich, als sie am nächsten Morgen ohne mich abreisten. Allein zurückgeblieben, ahnte ich nicht, daß ich vier Jahre an diesem Ort verbringen sollte, wohin ich für vier Tage gekommen war. In Paris hatte ich gelernt, mich an die Einsamkeit zu gewöhnen; hier, in Wechel der Zande, sollte ich lernen, sie zu lieben. Kaum allein, ging ich auf Entdeckungsreisen aus in dieser Gegend dünner Tannenwälder und weiter, sumpfdurchzogener Ebenen. Ihr Zauber wuchs, je vertrauter meine Augen mit den neuen, unerwarteten Farbharmonien wurden. Rasch merkte ich, daß man diese Landschaft ebensowenig überfallen durfte wie ein junges Mädchen, dessen Vertrauen man gewinnen will. Ich überließ mich dem Zauber und wartete mit der Arbeit, bis er mich ganz erfüllte. Bald sah ich, daß die Haltung der Bauern bei der Arbeit nichts Heroisches hatte. In dieser Landschaft ist alles vom Ackerboden bestimmt; Mensch und Tier sind von dem Übermaß an Anstrengung verunstaltet, das die Bearbeitung solch karger Erde fordert. Trotzdem fesselten mich die Vielfalt der Bewegungen und Gesten dieser armseligen Menschen ebensosehr wie die Phänomene des Lichtes. Zugleich begann ich, die Handhabung der verschiedenen Geräte des Ackerbaus zu erlernen: | |
[pagina 34]
| |
Spaten, Pflug, Egge, Sense und Dreschflegel. Weil ich bereit war, die Arbeit mit ihnen zu teilen, nahmen die Bauern der winzigen Gemeinde mich bald als einen der ihren auf. A.-J. Heymans, als Charakter und Begabung der bedeutendste Maler der Schule von Wechel der Zande, lächelte freundlich, wenn er mich in blauer Bluse und Holzpantinen sah, und gab mir den Namen ‘Luxusbauer’. Trotzdem brachte Heymans meinen Studien und Fortschritten viel Interesse entgegen. So viel, daß er schon damals (1886) Octave Maus, den Sekretär der Vereinigung ‘Les Vingt’, auf mich hinwies. Madeleine Maus, die Historikerin der künstlerischen Aktivität der ‘Vingt’ - ihrer seit 1884 jährlichen Ausstellungen, der Konzerte und Vorträge -, hat den Brief Heymans an Octave Maus veröffentlicht, in dem es heißt: ‘Ich habe diesen Sommer einen jungen Maler kennengelernt, der mir sehr begabt zu sein scheint. Er wohnt in Antwerpen, und es besteht die Gefahr, daß er dort versandet. Meiner Ansicht nach würde er gut zu den ‘Vingt’ passen...’ Octave Maus hatte dann den Maler Théo van Rysselberghe, meinen späteren Freund, konsultiert, der antwortete: ‘... in wenigen Worten meine Meinung über van de Velde: ein begabter junger Mann, zweifellos. Persönliches ist noch nicht zu sehen, aber das könnte kommen. Offen gestanden, ich finde nichts Außerordentliches. Aber von den ‘Vingt’ haben viele weniger gut begonnen.’
Man kann sich kaum drei Männer von ähnlicher Geradheit, Rechtschaffenheit und Charakterfestigkeit vorstellen wie Heymans, Rosseels und Crabeels, die sich selbstlos ihrer Kunst und den Opfern hingaben, welche sie von ihnen verlangte. Sie hatten ihr Leben ihren künstlerischen und moralischen Überzeugungen angepaßt. Alle drei waren von dem Gedanken der Notwendigkeit einer sozialen Erneuerung durchdrungen. Der innigste, tiefste Kontakt mit der Natur war ihr Ideal. Ihre Überzeugung war eine Religion der Güte, die sie darin bewiesen, daß sie das bescheidene Leben der Dorfbewohner teilten und ihre eigenen Sorgen und Freuden denen der kleinen Dorfgemeinde gleichsetzten. Alle drei waren über fünfzig Jahre alt und hatten ein Ansehen erlangt, das ihnen alle materiellen Vorteile gesichert hätte, die das Stadtleben bietet. Aber sie zogen es vor, in der Entsagung und unter Verzicht auf alle äuße- | |
[pagina 35]
| |
ren Ehren zu leben, die der Eigenliebe schmeicheln. Sie erschienen mir wie Missionare, die sich einem Leben mit primitiven Menschen auf kargem Boden verschrieben haben; Missionare der Religion des Lichtes und des Glückes, das den Menschen gewährt wird, die in seinem Glanze leben. Ich glaube mich nicht getäuscht zu haben, wenn ich in einem in der ‘Revue Générale’ 1889 erschienenen Aufsatz über A.-J. Heymans schrieb, daß er als erster von der Einheit erschüttert war, die das Wunder des Lichts hervorbringt, das Menschen und Dinge gleichsam aufsaugt, so daß sie sich vermischen und vereinen. Heymans war noch stärker als seine beiden Freunde vom Pantheismus durchdrungen, und seine Güte schien mir allumfassender. Ich schloß mich mehr an ihn als an Crabeels und Rosseels an, die beide dogmatischer und sektiererischer waren. Beides stand im Widerspruch zu meinem Wesen und meiner Natur, der es damals schon widerstrebte, Gewalt auszuüben oder sich der Gewalt zu beugen. Unter diesen ‘Missionaren’ betrachtete ich mich als ‘Novizen’. Die Strenge der Lebensauffassung dieser Meister, die mich spontan als Jünger und Freund aufgenommen hatten, wurde auf natürliche Weise zur Regel meines eigenen Daseins. Ich nahm die Entbehrungen auf mich, die sie sich selbst auferlegt hatten. Zu Beginn trafen sie mich wegen meiner Jugend und der vollständigen Isolierung besonders hart. Ich lebte allein im bescheidenen Gasthaus in der Mitte des Dorfes, wo sich noch die Kirche, der Friedhof und das Haus des Müllers befanden. Dieses Haus sah düster aus; den Eingang flankierten vier Linden, im Erdgeschoß befand sich das einzige Kolonialwarengeschäft, in dem zum Ärger meiner Wirtsleute auch Alkohol ausgeschenkt wurde. Die Rivalität beider Familien beschäftigte alle. Je nachdem, ob man sich in der einen oder der anderen Schenke niederließ, nahm man Partei für die ‘Montague’ oder die ‘Capulet’. Dies alles spielte sich vor dem Fenster meines Zimmers ab. Rhythmus und Sinn dessen, was sich im Dorf ereignete, wurden von diesem Hin und Her bestimmt. Jeden Tag um die gleiche Zeit kamen die Feldarbeiter auf dem Weg zu den Äckern oder auf dem Rückweg zu den Mahlzeiten vorbei; die Viehherden zogen vorüber, und zu den Zeiten der Ernte war der Platz von Karren mit Getreide, Heu, Kartoffelsäcken und Rüben vollgestopft. | |
[pagina 36]
| |
Die Kirche, ein fader roter Backsteinbau, erwachte nur zur Zeit des Gottesdienstes zum Leben. An Sonntagen zog sie eine zahlreiche herausgeputzte Menge an; je nachdem, ob man es eilig hatte oder nicht, bewegte man sich schweigend und ernst oder laut und unordentlich dem Portal zu. Nach Schluß des Gottesdienstes versank die Kirche sofort wieder in Schlaf wie eine alte Frau, die müde wird vom Geschichtenerzählen. Nur noch das gleichmäßige, durchdringende Ticken der Turmuhr war zu hören. Vier Jahre lang hörte ich das Herz des Dorfes schlagen, am Tage und in der Nacht, wenn mich die Arbeit oder das Lesen wach hielten, während alle Menschen und Tiere schliefen. Langsam nahmen die Regelmäßigkeit und das Gewicht dieser Vorgänge von meinem eigenen Dasein Besitz; sein Rhythmus wurde mir um so klarer, als ich die Wichtigkeit dieses täglichen Ablaufes erkannte. Die unruhige Beobachtung der ersten Monate wich stiller, glückseliger Betrachtung. Eine Ruhe ergriff mich, die ich für Glück hielt, und von da an tat ich meine Arbeit, als unterliege sie den strengen Regeln und der Disziplin eines Klosters. Auf den Feldern beobachtete ich die Arbeit der Männer und Frauen, denen die Kinder und Tiere geduldig halfen. Ich quälte mich damit, den Sinn alles dessen, was ich sah, herauszufinden. Mir schien, daß die Feldarbeit mit den Geräten, die sich seit Urzeiten kaum geändert hatten, es ermöglichen könnte, die Bewegungen und Gesten wiederzufinden, in denen sich das Absolute offenbart. Das Ergebnis dieser Beobachtungen war eine kritische Studie ‘Du paysan en peinture’ (Der Bauer in der Malerei), die das Problem unter geschichtlichen, ästhetischen und sozialen Gesichtspunkten untersuchte. Ich besitze noch einige Pastellzeichnungen aus dieser Epoche. Über ihren Wert mache ich mir keine Illusionen. Aber sie geben eine Vorstellung von der Richtung meiner Versuche, eine radikale Zeichenschrift zu finden, deren Linien erbarmungslos den von der Arbeit entstellten und verkrümmten Leibern meiner Modelle folgten. Wichtiger jedoch erscheint mir heute, daß sich in diesen Zeichnungen die ersten Anzeichen einer exakten Vorstellung von der Natur der Linie überhaupt finden. Es mag seltsam erscheinen, daß sich mir der Sinn der Linie erst so spät enthüllte. Allerdings wissen die wenigsten Maler und Zeichner, was das elementare Fundament ihrer Kunst ist: der Sinn, die Natur und die Funk- | |
[pagina 37]
| |
tion der Linie. Sie betrachten die Zeichnung als mehr oder weniger angewandte Kalligraphie, mit der man mehr oder weniger genau wiedergibt, was die Aufmerksamkeit erregt. Nur wenige betrachten und empfinden die Zeichnung als spontane gestische Manifestation, die von den Akzenten und Schwüngen der Linie hervorgerufen wird; die unser ganzes Wesen erfüllt, wie eine Fahne oder ein Segel im Wind schwingt, wie der Klang der Stimme oder eines Instrumentes, der sich durch die Lüfte bewegt. Die Leidenschaft, die ich für die Linie empfinde, entstand in dem Augenblick, in dem mir diese Wesenszüge der Zeichnung klarwurden. Das Glück dieser Entdeckung dauerte nicht lange. Im Augenblick, in dem ich die Früchte einer so vollständigen Befreiung hätte ernten und mit sicherem Schritt an die Eroberung einer persönlichen künstlerischen Vision hätte gehen können, riß mir eine Krise Bleistift und Pinsel aus der Hand. Meine physischen Kräfte hatten plötzlich versagt. Ich hatte in Wechel der Zande zu wenig gegessen. Ich las nicht nur bis spät in die Nacht, sondern auch während der Mahlzeiten. Ich las so intensiv, daß ich zu essen vergaß, ja, daß ich es verlernte. Mit Vorliebe las ich soziologische Bücher oder Romane mit sozialer Tendenz. Unter den soziologischen Schriften solche radikalster Richtung, unter den Romanen Werke von Zola, die mir zum ersten Male die Hintergründe des Elends der Arbeiter in den Städten und der Bauern enthüllten, sodann Bücher von Gladel und russische Romane in miserablen französischen Übersetzungen. Die Abende waren der Lektüre des ‘Zarathustra’ und anderer Werke Nietzsches gewidmet. Lange meditierte ich über die Gedanken des ‘Philosophen mit dem Hammer’ - wie er sich selber nannte -, die mich besser nährten als die wirkliche Nahrung. Dann griff ich zu der an meinem Kopfende liegenden Bibel, und die elementare Weisheit der Patriarchen des Alten Testamentes beruhigte meinen Geist, bis mich der Schlaf hinwegtrug.
Um diese Zeit - im Sommer 1887 - kam meine Mutter zu mir nach Wechel der Zande. Es war ein verzweifelter Schritt - sie verließ ihr Heim, weil sie einfach nicht mehr konnte. Endlich, zum ersten Male, gönnte sie sich einige Ruhe. Sie hätte es nie getan, wenn sie diesen Aufenthalt nicht als einen Besuch bei mir auf dem Lande hätte bezeichnen können. Ihr kör- | |
[pagina 38]
| |
perlicher Zustand war von einer Krankheit untergraben, deren Namen - aus Unwissenheit oder Entsetzen - niemand auszusprechen wagte. Mein Vater, der sich über den tödlichen Charakter ihrer Krankheit hätte klar sein müssen, hielt eine Illusion aufrecht, die wir mit ihm teilten. Sofort nach dem ersten Besuch des Landarztes, mit dem ich mich im Laufe seiner Visiten bei den Kranken des Dorfes angefreundet hatte, stellte es sich heraus, daß meine Mutter von unheilbarem Krebs befallen war. Von diesem Augenblick an widmete ich mich ausschließlich ihrer Pflege. Ich wurde Krankenwärter; nichts anderes existierte mehr für mich. Die Monate, die meine Mutter bei mir in dem ärmlichen Dorf verbrachte, erschienen mir später wie ein langer Aufenthalt in einem Garten. Ich erinnere mich, daß es meine größte Sorge war, ob die Sonne, die ihren armen Körper wärmen sollte, am nächsten Tage aufgehen würde oder nicht. Wenn sich meine Mutter unter den großen Obstbäumen niedergelassen hatte, setzte ich mich zu ihr. Wir brachen selten das Schweigen, das wir als ebenso wohltuend empfanden wie die Wärme und das Licht. Dann schlief meine Mutter ein, und ich betrachtete unbeweglich die Blässe ihrer Haut, die durch ihre schwarze Trauerkleidung noch verstärkt wurde. Sie löste sich langsam von allem, was sich nicht unmittelbar auf die Zukunft meines Vaters oder ihrer Kinder bezog. Besonders über meine Zukunft machte sie sich Sorgen. Alle meine Brüder hatten sich eine selbständige Existenz geschaffen. Nur ich hatte wenig Aussicht, mich von der materiellen Hilfe meines Vaters freizumachen. Ich bemühte mich, solchen Gesprächen das Gewicht zu nehmen, um sie von ihren dunklen Gedanken abzubringen. Ich erklärte ihr meine Neigung zu den einfachen Menschen, wie wenig ich zum Leben brauchte und welche Befriedigung mir die Liebe zur Natur und zum ländlichen Leben bereite. Sie konnte mein Vertrauen in die Zukunft nicht teilen. Auch nicht, als ich ihr erklärte: ‘Wenn ich für mich selbst sorgen muß, bevor ich als Künstler Erfolg habe, so werde ich Hirte. Ich nehme mir ein schönes Buch mit und werde bestimmt glücklich sein.’ Sie hatte bei dem Gedanken, daß dies möglich werden könnte, nur ein nachsichtiges Lächeln für mich. Und wenn ich zu ihren Füßen saß, meine Hand in der ihren, dann strich sie mir leise über den Kopf, und ich erlebte wieder, was seit meiner Kindheit mein tiefstes Entzücken war. | |
[pagina 39]
| |
Zu Beginn des Winters 1887/88 kehrten wir nach Antwerpen zurück. Im ersten Sommermonat 1888 starb sie, ohne daß ich sie einen Tag, eine Nacht oder eine Stunde verlassen hätte. Meine durch das Leben in Wechel der Zande ohnehin geschwächten körperlichen und seelischen Kräfte schwanden dahin. | |
Kontakt mit neuen IdeenIn diesem Zustand suchte ich nach dem Tode meiner Mutter Trost und Erholung in Blankenberghe, wo mein ältester Bruder ein Haus besaß. So verbrachte ich den Sommer am Meer und kehrte erst zu Beginn des Winters wieder nach Wechel der Zande zurück. Seit langem hatte ich das Gefühl, untätig, ohne Ziel zu leben. Die Studien und Bilder in meinem ‘Atelier’ waren mir fremd geworden, und auch meine Wirtsleute, an die ich mich vor der Abreise nach Antwerpen so eng angeschlossen hatte. Sie überließen mich mir selber und brachten dadurch ihre Achtung vor meinem Kummer zum Ausdruck. Um meine Zuneigung wiederzugewinnen, strengte sich Phile an, ihre derbe Sprache und ihre schroffen Manieren zu mildern. César nahm mich auf die Jagd mit, die er mit dem natürlichen Anstand betrieb, der sein Wesen auszeichnete. Das große Porträt meiner Mutter, das ich während ihres Aufenthaltes in Wechel der Zande gemalt hatte, stand auf einer Staffelei mitten im Atelier. Ich verlor mich nur zu oft in seiner Betrachtung. In meiner Niedergeschlagenheit konnte ich mich nicht entschließen, Bleistift, Pastell und Palette wieder in die Hand zu nehmen. Mit Ausnahme der Arbeit nahm ich meine früheren Gewohnheiten wieder auf. In meinem Zimmer fand ich auf dem Klavier, das ich in den ersten Tagen meines Aufenthaltes nach Wechel der Zande hatte kommen lassen, die Hefte mit Beethovens Sonaten wieder. In der Mitte stand der große Tisch, bedeckt mit Büchern und Zeitschriften, in denen ich beim Essen und an den langen Winterabenden las. Unter den Vorzeichen des beginnenden Frühlings nahm ich Pinsel und Palette wieder zur Hand. Und in Monaten fieberhafter Aktivität und stärkster Spannung suchte ich das zu entwickeln, was viele in meinen Arbeiten | |
[pagina 40]
| |
bisher vermißt hatten: meine Persönlichkeit. Bis jetzt hatte ich ‘gemalt, wie der Vogel singt’, um einen Ausdruck Camille Pissarros zu verwenden. Ich war in Wechel der Zande mit höchst widerspruchsvollem künstlerischem Gepäck angekommen und hatte mich zuerst freizumachen von dem, was ich an der Antwerpener Akademie, im Atelier von Verlat und bei Carolus-Duran gelernt hatte. Nun galt es, den wahren Sinn des Impressionismus zu entdecken. Die impressionistische Technik eignet sich besser als jede andere für den Ausdruck vitalen Reichtums und strahlender Fülle. Sie kam meiner vibrierenden und spontan reagierenden Natur entgegen. Wenn nicht im vierten Salon der ‘Vingt’ (1887) eine große Komposition von Seurat uns eine neue, auf radikale Anwendung neuer Theorien begründete Technik enthüllt hätte, würde ich wahrscheinlich weiter ‘gesungen’ und meine Laufbahn als Maler erfolgreich und ohne Hindernis weitergeführt haben. Seurats ‘Dimanche de la grande Jatte’ erschütterte mich aufs tiefste. Ich fühlte mich vom unwiderstehlichen Drang ergriffen, mir so rasch und so gründlich wie möglich die Theorien und fundamentalen praktischen Prinzipien der neuen Technik anzueignen. Zwei junge Pariser Maler, Georges Seurat und Paul Signac, suchten unabhängig voneinander nach einer Technik, mit der sie die Theorien der Physiker Chevreul und N.O. Rood, dessen Werk ‘Wissenschaftliche Theorie der Farben’ starkes Echo ausgelöst hatte, in die Praxis umsetzen wollten. In einer Ausstellung, zu der sie von den Meistern des französischen Impressionismus Claude Monet, Camille Pissarro, Renoir, Sisley und Degas eingeladen worden waren, erregten die Bilder der beiden Maler starkes Aufsehen. Die Bilder waren nach dem Prinzip der Teilung der Farbtöne (division des tons) gemalt, das heißt unter ausschließlicher Verwendung der Spektralfarben, die entsprechend den Theorien der beiden Physiker in Punkten auf die Leinwand aufgetragen sind. Kein Mischen der Farben mehr auf der Palette; keine Ockertöne, keine ‘Erdfarben’. Das Prinzip der Division der Töne und die unerbittliche Gegenüberstellung der Einzeltöne mußte zur pointillistischen Technik führen, die man Neo-Impressionismus nannte. Das Publikum und die Fachkritik brauchten Zeit, um zu erkennen, daß der Neo-Impressionismus einen Bruch bedeutete. Er setzt an die Stelle der chemischen Mischung die optische Mischung, die erst auf der Netzhaut des Auges zum bildlichen Zusammenschluß führt. | |
[pagina *5]
| |

7 Henry van de Velde: Sitzende Frau, Kohlezeichnung
| |
[pagina *6]
| |

8 Théo van Rysselberghe Octave Maus, 1885

9 James Ensor: Willy Finch
| |
[pagina *7]
| |

10 Henry van de Velde: Strand von Blankenberghe, 1888
| |
[pagina *8]
| |

11 Max Elskamp, 1903

12 Théo van Rysselberghe, 1908

13 Edmond Picard, 1903
| |
[pagina 41]
| |
In seiner Schrift ‘De Delacroix au Néo-Impressionisme’ erläutert Paul Signac die neue Theorie. Er beschreibt überzeugend klar die Scheidung der beiden Systeme der Malerei. Seine robuste Natur eines Matrosen kümmerte sich nicht um die Katastrophe, zu der die Technik der Punktmalerei (pignolage) - ein neues Wort, das er erfand - bei einem sensiblen Menschen führen konnte, der auf sichtbare Eindrücke unmittelbar reagiert. Ich habe mein Leben lang den ‘Schock’ nicht vergessen, den die ersten Eindrücke der neuen Maltechnik bei mir hervorriefen. Seurat war eine völlig andere Natur als alle übrigen Anhänger des Neo-Impressionismus. Niemanden von uns empfand er als Freund. Signac brachte er Achtung entgegen, aber er zeigte sie nur in Augenblicken, die für ihn selbst schwierig waren. Abgesehen von Signac lud er niemanden von uns in sein Atelier ein. Bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen er mit uns zusammen war, in Paris oder in Brüssel bei den Zusammenkünften der ‘Vingt’ oder bei den Diners im Hause Edmond Picards, blieb er stumm. Korrekt gekleidet, verbarg er sein Herz, das er gegen jede Ablenkung schützte. Wenn er seine wunderbaren schwarzen Kreidezeichnungen schuf, legte er Rock und Weste ab; wie um die Kaltblütigkeit zu betonen, sagte ich mir. Diese Zeichnungen wären demnach das Resultat der Ausschaltung einer zurückgedrängten Sensibilität. Im Salon des folgenden Jahres 1888 zog Paul Signac den ganzen Zorn der Kritik und der entfesselten Öffentlichkeit auf sich. Dreizehn Bilder ließen die strenge Arbeit erkennen, der sich der Maler unterzogen hatte. Als erster der ‘Vingt’ hatte sich der Maler Willy Finch den divisionistischen Malprinzipien angeschlossen. Zum ersten Male hatte auch Toulouse-Lautrec an der Ausstellung teilgenommen mit dem Erfolg, daß der Kunstkritiker des ‘Courrier Belge’ heftigsten Protest erhob gegen ‘die Regierung, die die Räume des Museums für eine Ausstellung von Schwindlern zur Verfügung stellte, die das Publikum, die Kunst, den guten Geschmack und die Sitten verhöhnten’. Ein Vorfall am Tag vor dem Ende der Ausstellung, an der auch Seurat teilgenommen hatte, war für uns alle eine Lektion über Würde und Bescheidenheit; sie zählt zu den schönsten und seltensten in den Annalen des modernen Kunstlebens. Ein Käufer hatte nach dem Preis eines Bildes von Seurat gefragt, das einen Monat lang den gehässigsten Kundgebungen des | |
[pagina 42]
| |
Publikums ausgesetzt war, welches gegen den angeblichen Schwindel protestierte. Seurat, von der unerwarteten Möglichkeit eines Verkaufes verwirrt, antwortete: ‘Was den Preis der ‘Poseuses’ betrifft, so weiß ich wirklich nicht, was ich verlangen soll. Als Kosten rechne ich ein Jahr zu sieben Francs täglich. Sie sehen, wohin mich das führt. Kurz, ich möchte sagen, daß der Käufer den Preis auf dieser Basis berechnen kann.’ Wir, seine Jünger und Freunde, wußten, daß Seurat mit übermenschlicher Anstrengung bis spät in die Nacht arbeitete. Die neo-impressionistische Technik erlaubt es dem Maler, große Flächen mit Lokalton-Punkten zu bedecken. Daher konnte Seurat auch bei künstlichem Licht seine Arbeit unbegrenzt in den Abend und die Nacht ausdehnen. In diesem Jahr hielt ich mich nur kurze Zeit in Brüssel auf, weil es mich drängte, allein in die Wissenschaft von der Farbe einzudringen und mit der neuen malerischen Technik Erfahrungen zu sammeln. Im Laufe des Herbstes 1888 erfuhr ich, mitten in der Arbeit an einer Bilderfolge ‘Dorfleben’, daß die ‘Vingt’ drei neue Mitglieder ernannt hatten: Rodin, Georges Lemmen und mich. Wir ergänzten die vorgesehene Zahl von zwanzig Mitgliedern, die seit der Gründung der Vereinigung nicht mehr erreicht worden war. Mir kam der Augenblick, der einen meiner brennendsten Wünsche erfüllte, ungelegen. Die langsame, geduldige Arbeit an der pointillistischen Technik machte es mir unmöglich, am nächsten Salon (1889) mit einigermaßen durchgearbeiteten neo-impressionistischen Bildern teilzunehmen. So blieb mir nichts anderes übrig, als eine Auswahl aus meinen früheren, impressionistischen Bildern zu treffen und unbeirrt in der neuen Arbeitsmethode weiterzuschaffen. Lemmen und ich mußten zu unserem Bedauern feststellen, daß die Beiträge, die wir zwei ‘Junge’ zur Ausstellung brachten, in der Seurat mit einer zweiten großen Komposition vertreten war, nur wenig Aussicht hatten, ein ironisches, spöttisches oder wütendes Publikum zu interessieren. Madeleine Maus, die gewissenhafte Chronistin der Geschichte der ‘Vingt’, unterstreicht den Eintritt der beiden jungen Mitglieder: ‘Van de Velde liebt es, tätig zu sein, zu schreiben, zu sprechen, zu überzeugen. Ein ernster, eindringlicher, warmer Ton kommt ihm dabei zustatten. Von Natur ist er Theoretiker, und dieser besondere Zug seines Wesens führt dazu, daß jede Theorie, für die er sich einsetzt, für ihn zu einer Mission wird, als deren Apostel er sich fühlt.’ | |
[pagina 43]
| |
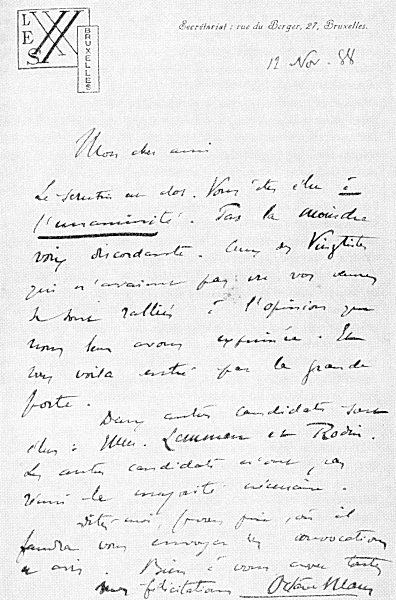
14 Brief von Octave Maus mit der Mitteilung der Ernennung van Veldes zum Mitglied der ‘Vingt’
| |
[pagina 44]
| |
Ihre Beschreibung Lemmens ist ebenso treffend: ‘So feurig van de Velde ist und so sehr er dazu neigt, Anhänger zu sammeln, so kühl ist Lemmen, verwirrend, ganz auf sich und seine Kunst konzentriert, sehr persönlich und bedächtig. Scheu bis zum äußersten, bitter und tief pessimistisch.’ Schon im Winter 1887 hatte ich in Wechel der Zande den Plan gefaßt, in Antwerpen eine Gruppe von Malern zu bilden. Ohne den Anspruch, die ‘Vingt’ in ihrem Kampf gegen die akademischen Mächte und die offiziellen Berühmtheiten zu unterstützen, sollte diese Gruppe die Offensive auf einem Boden ergreifen, wo Lokalpatriotismus, eingewurzelter Geschmack und Vorurteile nicht geringer herrschten als in Brüssel. Im Laufe eines gemeinsam mit unseren Antwerpener Freunden verbrachten Abends in einer Taverne, in der ich mich mit Max Elskamp traf, wenn ich meine Eltern besuchte, beschlossen wir, ein Comité zu bilden; seine Aufgabe sollte die Organisation von ähnlichen Ausstellungen sein wie die von Octave Maus und den ‘Vingt’ veranstalteten Salons in Brüssel. Wir redigierten einen Text an die Intellektuellen, die Künstler und Kunstfreunde, von denen wir annahmen, daß sie, wie wir, von der Feindseligkeit enttäuscht waren, die der ‘Cercle artistique d'Anvers’ den neuen Dingen auf allen Gebieten der Kunst entgegenbrachte. ‘Autorisiert durch den Respekt vor allen künstlerischen Dingen’, hieß es in dem Rundschreiben, ‘hat sich ein Comité konstituiert, das über den Interessen der einzelnen Schulen und Cliquen steht. Es wird sich durch Ausstellungen, Vorträge und musikalische Veranstaltungen der Verteidigung der neuesten künstlerischen Ideen und Ziele widmen.’ Unterzeichnet war der Text von den Advokaten Charles Dumercy und Georges Serigier, von Max Elskamp, dem Maler Georges Morren und von mir. Die ‘Association pour l'art indépendant’ (so nannten wir uns) - ihre erste Ausstellung fand 1887 statt - verfügte über nur bescheidene Unterstützung und über die zwangsläufig geringeren Eintrittsgelder als die der Salons der ‘Vingt’, zu denen die Besucher aus ganz Belgien strömten. Sie existierte nur drei Jahre. | |
[pagina 45]
| |
Als junger ‘Vingtiste’Seitdem ich Mitglied der ‘Vingt’ geworden und seitdem mir die Antwerpener Berichterstattung für die von Octave Maus, Edmond Picard und Emile Verhaeren geleitete Halbmonatsschrift ‘L'Art Moderne’ übertragen worden war, konnte ich an den Abenden teilnehmen, die Edmond Picard in den Wintermonaten in seinem Haus am Boulevard de la Toison d'Or in Brüssel veranstaltete. Seine Gäste waren die Elite der belgischen Politiker, die bekanntesten Mitglieder der Brüsseler Anwaltschaft, die führenden zeitgenössischen belgischen Maler und Bildhauer und die um den ‘Marschall der belgischen Literatur’, Camille Lemonnier, gruppierten Schriftsteller modernster Richtung. Es waren lebendige, brillante Abende. Oft erhielten sie besonderen Glanz durch die Anwesenheit auswärtiger Juristen, Politiker oder Künstler, vor allem im Februar während der Zeit des Salons der ‘Vingt’. Das Haus eignete sich vorzüglich für diese Empfänge. Ein weites Treppenhaus führte vom Erdgeschoß zur Galerie und zum großen Eßzimmer im ersten Stock. Es hatte nichts von kalter Pracht, sondern war immer von Gruppen belebt, die froh waren, dem Gedränge entfliehen zu können. An den Wänden einer langen Galerie hingen Bilder, Aquarelle und Zeichnungen von Meunier, Werke von Rops - unter ihnen das berühmte Aquarell ‘L'Attrapade’ -, rätselhafte Zeichnungen von Odilon Redon, von ihm vor allem die Originale zu den Illustrationen von Edmond Picards ‘Le Juré’. Vor den Tür- und Fensterpfeilern standen Skulpturen von Rodin, Meunier, van der Stappen und Jef Lambeaux. An den Wänden des Eßzimmers befanden sich Bilder, meist großen Formates, von den Malern der Gruppe ‘L'Art libre’: Dubois, Artan, Baron, Boulanger, Stobbaerts und J. Stevens. Gemälde von A.-J. Heymans und von Henri de Braekeleer vervollständigten die Sammlung. Wie nie zuvor konnten die Maler, Dichter und Schriftsteller in Edmond Picards Haus mit der intellektuellen Elite des Landes Kontakt aufnehmen. Sie konnten ihre Ideen und Meinungen verteidigen und gegen die ebenfalls anwesenden Kunstbonzen demonstrieren. Statt in Audienzen und sakrosankten Büros sprachen die Rebellen hier unmittelbar mit den Ministern und Direktoren. | |
[pagina 46]
| |
So sah man im Laufe eines Abends James Ensor, den meistdiskutierten und begabtesten unter den ‘Vingt’, im Gespräch mit dem Minister der Schönen Künste, Le Jeune; die noch kaum bekannten Dichter der Genter Gruppe, Charles van Lerberghe, Maurice Maeterlinck oder Grégoire Leroy als Tischnachbarn von Villiers de l'Isle-Adam, oder Gevaert, den ehrwürdigen Direktor des Königlichen Konservatoriums, zusammen mit Lekeu, einem der jüngsten belgischen Komponisten - und dies angesichts der ‘Versuchung des Antonius’ von Félicien Rops! Alles spielte sich auf natürlichste Weise ab. Edmond Picard, ständig in Bewegung, genoß offensichtlich diese Annäherungen. Er tauchte auf, nahm ein paar Minuten am Gespräch teil, und seine helle, scharfe Stimme beherrschte plötzlich das Stimmengewirr. Immer folgten ihm einige mondäne Verehrerinnen, die sich eifrig seinen Meinungen anschlossen. Nur ausnahmsweise blieb Edmond Picard länger als bis zehn Uhr. Meist verließ er seine Gäste auf die diskreteste Art und zog sich in sein Arbeitszimmer zurück. Ein anderer als ich wird eines Tages das wunderbare und mutige Leben Edmond Picards und den Einfluß beschreiben, den er in den verschiedensten Kreisen ausübte. Wir hatten uns um ihn geschart, der alle Mittel seiner brillanten politischen und wirtschaftlichen Situation und seine angeborene Genialität in den Dienst der freien künstlerischen Äußerung, der Persönlichkeit des Künstlers und der unantastbaren geistigen Unabhängigkeit auf den verschiedensten Gebieten der menschlichen Tätigkeit gestellt hatte. Edmond Picard repräsentierte - wie einer unserer Freunde, Francis Nautet, in einer Studie es ausdrückte - ‘einen der bedeutendsten menschlichen Werte Belgiens’. Für mich bedeuteten die Abende bei Edmond Picard eine Quelle der Kraft und des moralischen Ansporns, dessen ich immer mehr bedurfte. Ich arbeitete ohne Befriedigung und suchte verzweifelt in den Mappen voller Kreide- und Pastellzeichnungen nach Material für die Ausstellungen der ‘Vingt’, der ‘Association’ in Antwerpen und der ‘Indépendants’ in Paris, bei denen ich nicht nur aus Solidarität, sondern auch aus Ehrgeiz vertreten sein wollte. Meine Vorliebe für Pastell entsprang den Möglichkeiten, mit diesem ‘trockenen’ Material wie bei der pointillistischen Technik Farbe neben Farbe zu setzen. | |
[pagina 47]
| |

15 Titelholzschnitt von Georges Lemmen für die Zeitschrift ‘L'Art Moderne’, zum ersten Male erschienen 1893
| |
[pagina 48]
| |
Meine Kräfte erschöpften sich mehr und mehr; ich kämpfte gegen die ersten Anzeichen der Neurasthenie. Die Ärzte, die ich zu Rate zog, verordneten einen langen Aufenthalt am Meer, körperliche Arbeit, ausgedehnte Spaziergänge und eine unangenehme Diätkur. So verbrachte ich im Sommer 1889 wieder mehrere Monate als Gast in der Blankenbergher Villa meines Bruders. Während dieser Zeit lernte ich drei Männer kennen, denen ich zeitlebens verbunden blieb: den belgischen Dichter französischer Zunge Charles van Lerberghe und die zwei Advokaten Emile Vandervelde und Max Hallet. Auch die beiden letzteren stammten aus wohlhabenden, ‘anständigen’ Familien. Um so mehr hatte ihr Beitritt zur P.O.B. (Parti ouvrier belge, Belgische Arbeiterpartei) und ihre Teilnahme an den ersten ‘roten’ Versammlungen große Aufregung verursacht. Das Beispiel erregte Ärgernis. War nicht auch Louis de Brouckère gerade wie sie zu den Reihen der vom Teufel Besessenen gestoßen, zu Volders, Anseele und den Brüdern Defuisseaux? Die aus guten Familien stammenden Mütter, die ihre Töchter zu überwachen hatten, wurden unruhig. Nicht ohne Grund. Emile Vandervelde und sein Freund sahen keineswegs wie struppige und gefährliche Wesen aus, vor denen der brave Bürger sein Haus verschließt. Sie waren ebenso korrekt gekleidet wie die anderen jungen Leute, die sich an die reizenden jungen Mädchen heranmachten. Ihre Manieren waren nicht schlechter als die der anderen ‘Bewerber in spe’. Es hatte sich rasch herumgesprochen, daß sie literarisch und künstlerisch hochgebildet waren. Max Hallet erwies sich zudem als der beste, eleganteste Tänzer der Saison, und Emile Vandervelde bezauberte jung und alt durch seine fesselnden Erzählungen. Mit Interesse und Befriedigung habe ich seit jener Zeit den Aufstieg in hohe Ämter verfolgt, die beide im politischen Leben Belgiens eingenommen haben. Die damals entstandene Freundschaft wurde einige Jahre später erneut und gestärkt, als ich Emile Vandervelde und Max Hallet im Brüsseler ‘Volkshaus’ wiederbegegnete, wo wir mit vereinten Kräften im Rahmen der Belgischen Arbeiterpartei eine Kunstsektion ins Leben riefen. Charles van Lerberghe und ich führten eher ein zurückgezogenes Leben. Wir trafen uns an stilleren Teilen des Strandes. Die einzigen mondänen Pflichten, denen Charles nachkam, bestanden in Aufmerksamkeiten seiner Schwester und deren Freundinnen gegenüber. Sie wurden von ihm aus | |
[pagina 49]
| |
dem einzigen Grund erwartet, damit er, der verschlossene Dichter, nicht zu sehr als ‘Brummbär’ wirkte. Bruder und Schwester zogen die Aufmerksamkeit auf sich. Er trug den ‘Beach suit’ mit vollendeter Natürlichkeit, sie kleidete sich mit betonter Einfachheit, dem Ergebnis höchsten Raffinements. Ihr Gebaren, der Ton ihrer diskreten Unterhaltung ließen sie als Ausländer, scheinbar als ‘Briten’, erscheinen. Im Lärm der Strandpromenade konnten wir nur unwesentliche Worte wechseln. Aber wir hatten beide den Wunsch, uns näher kennenzulernen und anzufreunden. Charles van Lerberghe hatte in ‘La Wallonie’ die Novelle ‘Les Flaireurs’ veröffentlicht und gerade eben dieser, unter der Redaktion Albert Mockels stehenden, jungen Avantgarde-Zeitschrift einen Artikel ‘Serres chaudes’ (Treibhäuser) eingesandt. Er hatte mir zu verstehen gegeben, daß es sich um die Treibhauspflanzen handelte, die sein Freund Maurice Maeterlinck züchtete: ‘wunderbare schwarze Blumen wie von Fieber überhitzte kranke Seelen’. Wir wählten als Ort unsrer vertraulichen Zusammenkünfte ein Zelt am Deich gegenüber der von meinem Bruder bewohnten Villa. In einem Aufsatz über den Salon der ‘Vingt’ von 1892 erwähnte Eugène de Molder dieses ‘grüne Zelt’ als Motiv eines von mir ausgestellten Bildes, das ‘seine durchdringende Farbe mit wunderbarer Kraft über den Strand singen ließ, das Werk eines der feurigsten und radikalsten Jünger der Neuen Schule’ (‘Société Nouvelle’, März 1892). Van Lerberghe interessierte sich für meine Bilder und für meine Artikel in der Zeitschrift ‘L'Art Moderne’; ich wiederum bewunderte sein kleines Drama für Marionetten, das ich neben die Meisterwerke der dramatischen Literatur aller Zeiten stellte. Ich war aufs tiefste von der suggestiven Atmosphäre beeindruckt, in der sich die Figuren bewegten, die in primitiver psychologischer Reaktion einem Ereignis gegenüberstanden, das sie nicht begriffen - dem Tod. Tag für Tag beschäftigten wir uns mit den neuesten künstlerischen Ereignissen. Besonders deutlich erinnere ich mich an den Tag, an dem wir des unvergeßlichen Besuches von A. de Villiers de l'Isle-Adam im Kreise der ‘Vingt’ gedachten; die Nachricht seines Todes (19. August 1889) hatte uns gerade erreicht. Wir hatten damals - ohne uns zu kennen - tiefe Eindrücke von diesem großen Meister des Wortes und Kenner der Grausamkeiten | |
[pagina 50]
| |
der Welt empfangen. Er las drei Erzählungen, zuletzt den ‘Abschied Isabellas von Columbus’. Seine Worte haben sich mir unauslöschlich eingeprägt: ‘Geh - und wenn das Land, das du suchst, noch nicht geschaffen ist, so wird Gott als Preis für deinen Mut Welten aus dem Nichts entspringen lassen.’ Wenige Tage später kündigte mir van Lerberghe den Besuch Maeterlincks an, der ihm, als erstem, sein gerade vollendetes Stück ‘La Princesse Maleine’ vorlesen wollte. Ich wurde zur Teilnahme an der Vorlesung eingeladen und war betroffen, in diesem dramatischen Erstling Maeterlincks die gleiche betäubende, von drohender Angst erfüllte Atmosphäre zu finden wie in Lerberghes ‘Flaireurs’. Die Vorlesung bewegte mich aufs tiefste, und doch war ich schockiert von der Hemmungslosigkeit, mit der Maeterlinck sich die Gedanken- und Phantasiewelt seines intimsten Freundes angeeignet hatte. Die Eindrücke dieser Vorlesung haben mich lange verfolgt und gehindert, Kontakte zu Maeterlinck zu suchen. Später hat Maeterlinck in loyaler Weise die Beziehungen zwischen ‘La Princesse Maleine’ und van Lerberghes ‘Flaireurs’ offen zugegeben.
Während dieses Sommers 1889 war ich zwei befreundeten jungen Mädchen vorgestellt worden, die die Neugier der Badegäste erregten. Beide waren außergewöhnlich schön und beide Künstlerkinder. Die eine war die Tochter von Félicien Rops; der Vater der anderen war ein berühmter polnischer, seit Jahren in Paris wohnender Bildhauer. Sie hielten sich abseits der anderen jungen Leute. Mein häufiges Zusammensein mit den beiden Mädchen war aufgefallen. Ihre Bemerkungen, die - eher ironische - Art ihrer Beobachtung des belgischen Badepublikums lenkten mich von meinen Sorgen und von meinem Gesundheitszustand ab. Wir sprachen von ihrer und meiner Zukunft, von ihrem Eintritt in das Pariser Gesellschaftsleben, der im kommenden Winter stattfinden sollte. Sie sahen diesem ‘Ereignis’ gelassen entgegen und versprachen sich nichts Besonderes davon. Unter diesen Gesprächen wurden wir zu Freunden und zeigten die Befriedigung über unsere Begegnung vielleicht zu offen. Wem, zum Teufel, hätte dies mißfallen, wen hätte es verstimmen können? In welchem boshaften Hirn entstand der Plan zu einer Intrige, mit dem Ziel, den Bruch | |
[pagina 51]
| |
einer Verbindung herbeizuführen, die drei verwandte Seelen zusammengeführt hatte? Es war die Stiefmutter von Misia Godebska, die sich über mich und meine Existenzmittel erkundigt hatte! Eine kokette verblühte Megäre, auffallend gekleidet und mit Schmuck behängt. An ihrem Zeigefinger prangte ein großer Smaragd, der durch eine Kette mit einem breiten Armband verbunden war. Dieses barbarische Schmuckstück, das von einem Negerhäuptling hätte stammen können, flößte mir jedesmal, wenn ich ihr die Hand geben mußte, Widerwillen ein. Ich konnte diesen kaum verbergen, so daß sie ihn zweifellos bemerkte! Der Schlag, der mich treffen sollte, ging von dieser Frau aus, die Heiratsgedanken ausbrütete. Es hatte sich noch keine Gelegenheit gefunden, dem Vater von Misias Freundin vorgestellt zu werden. Eines Tages saßen wir zu dritt abseits des Strandes. Mademoiselle Rops sah ihren Vater kommen und sprang auf, um ihm entgegenzugehen. In plötzlicher Verlegenheit fand ich mich zum ersten Male mit Misia, dem bezaubernden Wesen, allein. Überraschend standen Félicien Rops und seine Tochter vor uns. Rops' Haltung war schroff; die kalte Klarheit seiner Worte entsprach dem Eindruck, der von seiner schönen Gestalt ausging, der eines Kavallerieoffiziers in Zivil. Ich erklärte ihm sofort, daß ich Künstler und Mitglied der ‘Vingt’ sei. Da reichte mir Rops, der vor kurzem ebenfalls von den ‘Vingt’ aufgenommen worden war, die Hand. Es entstand zwischen meinem berühmten Kollegen und mir ein Gespräch, das die beiden jungen Mädchen nur wenig zu interessieren schien; sie eilten zu den Kabinen, in denen man sich zum Baden umzog. Félicien Rops sprach sehr direkt über die Stellung des Künstlers in der Gesellschaft und über meine besondere Lage. Er verlangte klare Antworten, auch über meine materielle Situation. Ich hatte keinen Grund, seinen Fragen auszuweichen; es wäre vermessen gewesen, mich nach der Ursache seiner Fragen zu erkundigen. Ich berichtete ihm über mein Leben, seitdem ich mich in Wechel der Zande niedergelassen hatte, und erklärte ihm, daß meine Existenzmittel aus den bescheidenen Beiträgen meines Vaters bestünden, aus dem Talent, das mir einige mir bekannte Maler zusprachen, und aus dem Mut und der Hartnäckigkeit, mit der ich mich meinem Beruf als Maler widmete. Ich beobachtete meinen Gesprächspartner und hörte mir resigniert an, was er von Misia und ihrer Mutter zu sagen hatte. | |
[pagina 52]
| |
Nach der Rückkehr ins Haus meines Bruders fand ich langsam die Fassung wieder. Mir schien, als hörte ich ein zweites Mal die Worte Félicien Rops'. Warum hatte er mir die vertraulichen Mitteilungen über die schöne Freundin seiner Tochter gemacht? Plötzlich verstand ich. Der berühmte Zeichner, der den Ruf eines skandalösen Lebemanns mit überlegener Heiterkeit auf sich nahm, hatte Mitgefühl mit mir als dem Naiven gehabt, den er einen Weg einschlagen sah, der in einer Hölle geendet hätte, die Rops selbst wohlbekannt war. Sehr bald, gleich nach ihrem Debüt in den künstlerischen und mondänen Kreisen von Paris, würde Misia die ihr angeborene Rolle spielen, und junge und alte Lebemänner würden ihr zu Füßen liegen. ‘Die Existenz des Künstlers, junger Freund und Kamerad der ‘Vingt’ - Sie werden es erkennen, wie ich es erkannt habe -, muß, um würdig und glücklich zu sein, auf den stabilen Grundlagen sittlicher Kraft und moralischer Qualitäten ruhen, die man nur allzuleicht mit einem bürgerlichen Dasein verwechselt. Diese Tugenden sind nur echt, wenn sie dauerhaft sind’, betonte Félicien Rops. ‘Doch um wieviel großzügiger und tapferer muß die Frau eines Künstlers sein. Das größte Opfer, das sie zu bringen hat, besteht darin, für sich und die Ihren auf alle Arten des Luxus und der Verwöhnung zu verzichten. Nur ein materiell gesichertes Leben, auf welchem Niveau auch immer, vermag den Künstler vor Versuchungen und entehrenden Kapitulationen zu bewahren.’ Erst später konnte ich einsehen, wie sehr diese weisen Grundsätze auf Rops' eigenes Leben zutrafen. Einen Tag nach diesem Vorfall verließ ich Blankenberghe, ohne meine Freundinnen noch einmal gesehen und ohne mich von meinen Freunden verabschiedet zu haben. Schweren Herzens entfernte ich mich von dem Ort, an dem ich mir blitzartig über meine Lage klargeworden war. Als Mann von sechsundzwanzig Jahren war ich weit davon entfernt, die Bedürfnisse eines luxuriösen Haushalts in einer Metropole bestreiten zu können; ja, ich konnte nicht einmal daran denken - und wäre es auch in ferner Zeit -, in einem abgelegenen Dorf eine bescheidene Familie zu gründen. | |
[pagina 53]
| |
Calmpthout - ‘Vogelenzang’Den Rat eines alten Freundes, der mir empfahl, eine Reise in die weite Welt zu machen, konnte ich nicht befolgen, da ich meinen Vater nicht um das erforderliche Geld bitten wollte. Ohnehin bedrückte mich die materielle Abhängigkeit neben anderen Skrupeln, die ich meinem Vater gegenüber empfand. So wendete ich mich auf der Suche nach einem Hafen an diejenige meiner verheirateten Schwestern, an der ich seit meiner Kindheit am meisten hing. Sie verbrachte seit einigen Jahren mit ihrem Mann den Sommer in Calmpthout im Haus ‘Vogelenzang’. Ich war sicher, daß ich mit meiner Übersiedlung nach Calmpthout einen der liebsten Wünsche meiner Schwester erfüllte. Das Haus ‘Vogelenzang’ war anspruchslos, aber nicht ohne Charme. Es glich den flandrischen Häusern der Provinz Antwerpen, die sich Notare, Ärzte oder Industrielle, die sich zurückgezogen hatten, nach einigen Jahrzehnten lukrativer Berufstätigkeit zu errichten pflegten. Durch einige Landkäufe hatte mein Schwager seine Besitzung vergrößert, und eine Reihe von Arbeiten veranlaßte ihn, auch den Winter über in Calmpthout zu bleiben. Meine unerwartete Ankunft löste zudem ein Problem. Da er jeden Tag aus beruflichen Gründen nach Antwerpen fahren mußte, wäre meine Schwester den ganzen Tag allein gewesen. Kaum war das erste Erstaunen über meinen unerwarteten Vorschlag überwunden, wurde beschlossen, mir einen Schuppen zur Verfügung zu stellen und ihn in ein Atelier zu verwandeln. Man freute sich, daß ich nach mehr als vier Jahren mein einsames Leben in Wechel der Zande aufgeben wollte. Bald kamen die Kisten, in denen alles eingepackt war, was sich noch in meinem ‘Atelier’ in Wechel der Zande befand. Ich konnte mich dem Familienleben einfügen, das sich in einer Atmosphäre herzlichen und vollkommenen Einverständnisses abspielte. Die Befriedigung meiner Gastgeber und die beiden reizenden, aufgeweckten Kinder halfen mir, mich wieder zurechtzufinden. Meine Schwester richtete mir ein bescheidenes Zimmer im ersten Stock ein. Ein Fenster nach Osten, in der einen Ecke ein Bett, vor dem Fenster ein Tisch mit dem Blick auf die Weite der Felder und den Horizont. Ein | |
[pagina 54]
| |
Schrank und Regale, auf denen ich alles wiederfand, was sich in Wechel der Zande an Büchern, Zeitschriften, Notizen und Manuskripten angesammelt hatte. Ich ahnte nur zu deutlich den bevorstehenden Bruch mit meiner Vergangenheit und meiner Karriere als Maler. Den Weg durch das Labyrinth meiner Bücher sah ich weniger deutlich als meine Schwester Jeanne, die sie bei der Einrichtung meines Zimmers in einer Unordnung zusammengestellt hatte, die nicht geringer war als in Wechel der Zande. Ein paradoxeres Nebeneinander hätte man nicht finden können: die Bibel für zwanzig Sous mit Lesezeichen bei meinen Lieblingskapiteln der Bergpredigt, des Predigers Salomonis, des Hohen Liedes, der Apokalpyse; daneben ‘Gott und Staat’ von Bakunin, die Einführung in das Leben Christi neben dem ‘Kommunistischen Manifest’ von Marx und Engels, das ‘Tagebuch eines Revoltierten’ von Kropotkin, Nietzsches ‘Zarathustra’ neben den ‘Blümlein’ des heiligen Franziskus und Dostojewskis ‘Brüder Karamasoff’. Es war aber nur ein scheinbares Durcheinander. Durch alle diese Bücher und Zeitschriften, durch das ganze Durcheinander lief ein Gedanke wie ein roter Faden: die Auflehnung gegen den Egoismus der sozialen Verhältnisse am Ende des 19. Jahrhunderts, gegen die von der herrschenden Klasse heftig verteidigten Vorrechte. Die Zeitschriften, die sich stoßweise auf den niederen Gestellen in meinem Zimmer häuften, vervollständigten die Quellen, aus denen ich bisher meine geistige Nahrung geschöpft hatte. Durch sie war ich Rebell geworden, ohne mich auf ein einziges Dogma zu beschränken und ohne mich als Jünger einer dieser Autoren zu fühlen. Ein einziger Gedanke zog mich wie ein Magnet an: jener der brüderlichen Nächstenliebe. Mein Leben, wie ich es als Maler in Wechel der Zande geführt hatte, schien mir mit solchen Wünschen unvereinbar. Ebensowenig das Leben der Maler und Bildhauer, die ich kennen und bewundern gelernt hatte und die zu jener Zeit meine intimen Freunde waren: Camille Pissarro, Seurat, Signac, Luce, Augrand, Maurice Denis in Frankreich; Théo van Rysselberghe, Willy Finch, Constantin Meunier, Georges Minne, Adrien-Joseph Heymans, Emile Claus in Belgien; Jan Toorop und Jan Thorn Prikker in Holland. | |
[pagina 55]
| |
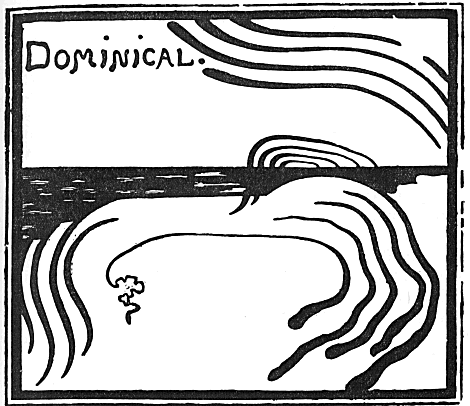
16 Holzschnitt van de Veldes zu Max Elskamps Gedichtband ‘Dominical’, 1892
Die Meditation zog mich mehr und mehr an. Vor allem im Zusammenhang mit der neuesten Entwicklung der Philosophie und Soziologie. Die im ‘Kommunistischen Manifest’ und auf den ersten internationalen Sozialistischen Kongressen geforderte Aktion der Massen war in Frage gestellt und überrundet durch die anarchistische Agitation und die Theorie der individuellen Revolte. Von diesem Augenblick an beschäftigte mich die Vorstellung einer neuen sozialen Gesellschaftsordnung mehr als die Frage, ob die Entwicklung der Malerei sich auf dem Wege des Pointillismus oder auf irgendeine andere Weise vollziehen würde. Vage Ideen erschienen vor meinem Geist. Ich ahnte die Möglichkeiten, die mit der Verwirklichung meiner sozialen Ideale verbunden sein könnten: | |
[pagina 56]
| |
die Wiederkehr der Kunst im ursprünglichen Glanz unverdorbener Schöpfung, die von unwiderstehlicher Lebensfreude getragen ist. Ich fühlte mich allein und ohne Führung. Soweit es meine physischen Kräfte erlaubten, nahm ich an den Arbeiten meiner Verwandten für ‘Vogelenzang’ teil. Aber nicht weniger war ich damit beschäftigt, eine Lösung, eine neue Technik, eine künstlerische Schrift zu finden, die mir dazu verhelfen sollten, auch weiterhin die Freuden zu genießen, die mir die Farbe und die Linie bereiteten. Die Zeichenschrift und die Technik des japanischen Farbholzschnitts, in jenen Jahren eine Offenbarung für uns junge Künstler, schienen mir die Voraussetzungen zu bieten, in einfacher Weise die Ärmsten der Armen darzustellen. Aber die wenigen Holzschnittversuche, die ich damals machte, waren natürlich weit entfernt von den Meisterwerken der Hiroshige oder Utamaro. Und auch mit meinen Erfahrungen mit trockenen, neben- und übereinandergesetzten ‘flachen’ Farbtönen gelangte ich nicht zum Ziel. Bei den geringsten Retuschen bröckelten die Farben unweigerlich ab. Nur ein Weg hätte weiterführen können: die Farbe durch farbige Tücher, das heißt durch geschnittene Tuchteile in verschiedenen Farben zu ersetzen. | |
Verzicht auf die Malerei - Der Weg zur angewandten KunstVor 1891 hatte es auf dem Kontinent im Reich von Form und Ornament nicht das geringste Anzeichen gegeben, das auf eine bevorstehende Befreiung von der Stil-Imitation hätte schließen lassen, in der die Kunsthandwerker ihr kümmerliches künstlerisches Leben fristeten. Da erschienen in den Schaufenstern der ‘Compagnie Japonaise’ in Brüssel die ersten Produkte, die von der Firma Liberty von England nach dem Kontinent exportiert wurden. Ich erinnere mich an das Aufsehen, welches diese Dinge beim Brüsseler Publikum machten, das sich auf dem Trottoir vor den Auslagen drängte. In keiner anderen kontinentalen europäischen Stadt waren zu jener Zeit ähnliche Dinge zu sehen. Es gab grazile Möbel, die mit Lack in lebhaftem Grün oder Rot überzogen waren; helle, freundliche Töpfereien, irisierende Gläser und Metall- | |
[pagina 57]
| |
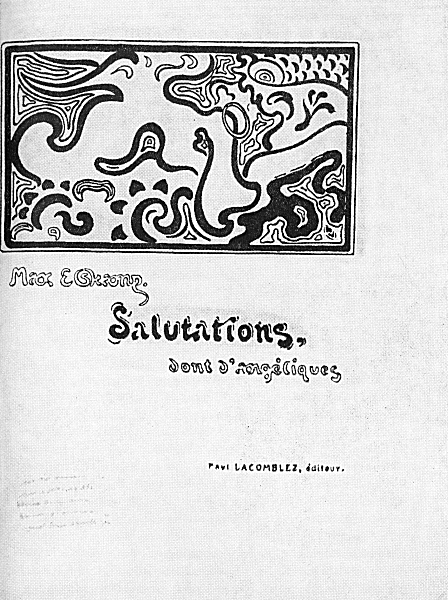
17 Holzschnitt van de Veldes zu Max Elskamps Gedichtb and ‘Salutations dont d'angéliques’
| |
[pagina 58]
| |
gegenstände, deren Formen nichts Abgebrauchtes, bedruckte Stoffe, Tapeten mit heiteren Mustern, die etwas vom Rhythmus der ‘Songs’ und ‘Dances’ hatten, die neuerdings aus den ‘Music-Halls’ vom Ufer der Themse in unsere Cafés importiert worden waren, deren zotige Couplets sie verdrängten. Wir genossen diese Dinge wie eine Art Frühling, der in unser Leben einbrach, in die graue Langeweile unserer Wohnräume mit ihren schweren, abgeschabten Möbeln, die jede Heiterkeit erstickten, mit all den verstaubten dummen Gegenständen, um die man herumschlich. Im Gegensatz zu ihnen leuchteten die Schaufenster der ‘Compagnie Japonaise’ in der Rue Royale wie kleine Kapellen; unsere Augen wurden erfrischt, unser Gefühl von einem schweren Druck befreit, wie die Seele eines Gläubigen nach dem Gebet. Zur gleichen Zeit hatten die ‘Vingt’ zum ersten Male einige Künstler zur Teilnahme am ‘Salon’ eingeladen, die als erste sich den angewandten Künsten zugewendet hatten: den Franzosen Chéret mit seinen Plakaten, den Engländer Walter Crane mit seinen illustrierten Kinderbüchern, Gauguin mit einigen Keramiken und den Maler Willy Finch, Mitglied der ‘Vingt’ seit ihrer Gründung, mit seinen gebrannten Tellern. Sie alle gehörten zu den ersten Deserteuren, die den ‘Künsten’ den Rücken kehrten. Der Bildhauer Paul Dubois, eine mächtige, athletische Gestalt, ein Künstler von sicherem Geschmack und unermüdlich in seiner Hilfsbereitschaft, leitete die Einrichtung des ‘Salons’. Zu seiner großen Überraschung mußte er diesmal einige Dutzend Vasen, Krüge und Teller ausstellen. Vitrinen waren nicht vorhanden. Paul Dubois entschloß sich, die einzelnen Gegenstände auf Sockel zu plazieren, die er in die Zwischenräume zwischen den Bildern an die Wand stellte. Durch die unmittelbare Nachbarschaft zu den Bildern unterstrich er die Bedeutung der ungewohnten Objekte. Der Kunsthandwerker hatte seinen Platz und seinen Rang unter den ‘freien Künsten’ wiedererobert. Die Ausstellungen machten keinen Unterschied mehr zwischen freier und angewandter Kunst. Im Salon von 1892 stellten die ‘Vingt’ dem Kunsthandwerk einen eigenen Saal zur Verfügung. Er war den Illustratoren der englischen Luxusrevuen mit Werken von Selwyn Image, Herbert Horne, Lucien Pissarro gewidmet. Den Ehrenplatz nahmen Vitrinen ein mit den schönsten illu- | |
[pagina 59]
| |
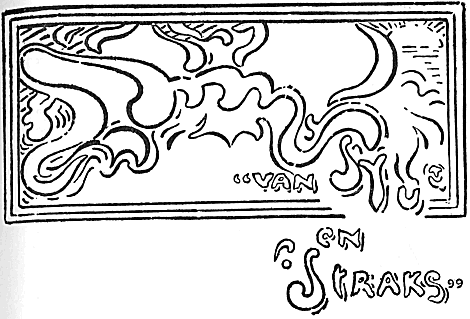
18 Titelholzschnitt van de Veldes zu ‘Van nu en straks’, 1893
strierten Büchern von William Morris, an den Wänden befanden sich Glasgemälde-Entwürfe von Emile Bernard und ein Karton für eine Broderie (Kunststickerei) von mir. Eine eindrucksvolle Auswahl von Keramiken (grès flambés) von Delaherche vervollständigte das Ausstellungsgut. | |
‘Van nu en straks’Von Calmpthout aus besuchte ich Auguste Vermeylen in Brüssel, der damals and der ‘Université Libre’ deutsche Philologie studierte. Vermeylen hatte eine Gruppe junger flämischer Schriftsteller gebildet, die sich von der Bevormundung der Provinzzeitschriften befreien wollten und darauf brannten, ein eigenes Organ zu besitzen, in dem sie ihre Arbeiten ebenso frei | |
[pagina 60]
| |
dem Publikum zur Diskussion stellen konnten wie ihre Kameraden französischer Zunge in der ‘Jeune Belgique’, der Halbmonatszeitschrift ‘L'Art Moderne’ und in der ‘Société Nouvelle’; ebenso frei wie wir, die Maler und Bildhauer in den Ausstellungen der ‘Vingt’ in Brüssel oder der ‘Art Indépendant’ in Antwerpen. Da war es an mir, ihn vor der Illusion zu warnen, auf dem Kontinent sei ein ähnlicher Aufstieg möglich wie jenseits des Kanals; ich zweifelte, ob die notwendigen finanziellen Mittel und vor allem die künstlerischen Arbeitskräfte zur Verfügung ständen. Zudem wies ich darauf hin, daß das Niveau der Buchkunst in England zu keiner Zeit so tief gesunken war wie bei uns. Es gab damals in unseren Reihen keinen Künstler, der fähig, neue Lettern zu entwerfen, keinen Drucker, der bereit gewesen wäre, neue Buchstaben zu prägen und gießen zu lassen. Unter solchen Voraussetzungen schien mir die Aufgabe, für die ich die Verantwortung übernehmen sollte, zumindest abenteuerlich. Vermeylen folgte aufmerksam meiner Darstellung der Lage; er wurde immer munterer, als ich ihm präzisierte, worin die Mitarbeit meiner Freunde bestehen werde. Am Schluß meines langen Besuches beschlossen wir, in Kontakt zu bleiben. Ich bestand darauf, daß unsere nächste Besprechung bei mir im Haus ‘Vogelenzang’ in Calmpthout stattfinden sollte. Die Zeit drängte, da ich mit einigen Freunden bei Théo van Rysselberghe zum Déjeuner geladen war, der sich mit seiner jungen Frau in der Avenue Louise, in der Nähe des Bois de la Cambre ein Heim eingerichtet hatte, wo alles - Möbel, Vorhänge, Matten und Teppiche - zum ersten Male in hellen, klaren, lebendigen Farben gehalten war. Mehrere Wochen später meldete mir ein Telegramm aus Den Haag für den nächsten Tag die Ankunft Auguste Vermeylens in Calmpthout. Ich holte ihn am Bahnhof ab. Er hatte ein ziemlich voluminöses Paket mit Dokumenten für unsre Besprechung über die geplante Zeitschrift unter dem Arm. Bei Tisch im Hause meines Schwagers erzählte uns Vermeylen Einzelheiten über seinen Aufenthalt in Holland, über seine Besuche bei Verwey und bei der Witwe Théo van Goghs. Nach dem Essen führte uns meine Schwester zu einem Tisch unter einem Apfelbaum, dessen belaubte Zweige mit den in voller Blüte stehenden Sträuchern eine Art Raum bildeten. Es | |
[pagina 61]
| |

19 Holzschnitt van de Veldes zu ‘Van nu en straks’, 1893
war zu Beginn des Sommers; ein strahlender Tag. Die Farbtöne bildeten einen sonoren Akkord aus dem Weiß, dem Rosa und Gelb der Schneeballen, Azaleen, des Goldregens und der Syringen. Seit unsrer ersten Unterhaltung hatten wir nichts voneinander gehört. Er brachte nur gute Nachrichten: die Redaktion war gebildet, die Finanzfrage geregelt. Von den Redakteuren der holländischen Zeitschrift ‘Nieuwe Gids’ mit größter Freundschaft empfangen, hatte er Hermann Gorter und Albert Verwey als Mitarbeiter gewonnen. Ich hatte mich nicht nur an James Ensor, Georges Minne, Georges Lemmen, Théo van Rysselberghe und Willy Finch gewendet, sondern mich auch in England mit Lucien Pissarro und auf dessen Empfehlung mit Charles Rickets in Verbindung gesetzt. In Holland hatte ich Thorn Prikker, Jan Toorop, Jan Veth und Roland Holst als Mitarbeiter gewonnen. | |
[pagina 62]
| |
Vermeylen warf einen langen Blick auf meine Liste und auf mich selbst. Und ich las in seinen Zügen Befriedigung und Erstaunen. Die Schritte, die ich bei einigen Druckern unternommen hatte, bestätigten meine bei unsrer ersten Besprechung gemachte Vorhersage. Keine Druckerei, bei der ich gewesen war, besaß, was ich suchte. Die Drucker benutzten alle ähnliche Schriften, Produkte einer seit drei Jahrhunderten zunehmenden Verwässerung. Keine Schrift war zu finden, die die Reinheit der ‘Kursiven’- oder der ‘Antiqua’-Lettern von Janson oder Garamond erreicht hätte. Ich dachte, die für den Anfang unabänderlichen Nachteile durch gute ‘mise en pages’, durch harmonische Proportionen des Satzspiegels, durch neuartige, überzeugende Entwürfe expressiven linearen Charakters aufwiegen zu können, wie ich sie für die Einbände der beiden ersten Gedichtsammlungen Max Elskamps mit einigem Erfolg verwendet hatte. Vermeylen war offenbar in Gedanken versunken und mit anderen Dingen beschäftigt. Plötzlich bemerkte ich eine Änderung in seiner Haltung; eine neue Idee schien ihn zu erfüllen, eine ‘Realität’, die ihn hypnotisierte und gebieterisch alle nebensächlichen Gedanken beiseite schob. Ich reichte Likör. Vermeylen blieb dem ‘alten Schiedamer’, ich dem ‘Benediktiner’ treu. In einem langen Schweigen leerten wir unsre Gläser. Goldene Strahlen drangen durch die Zweige des Apfelbaumes, Sonnenflecken zeichneten sich auf dem Tischtuch und auf den Dingen ab, die herumlagen, auf dem Boden, um uns herum - sie kämpften mit den Schatten. Vermeylen ergriff diesen Moment und schnürte das Paket auf, das er mitgebracht hatte. Es erschien ein großes Buch, das er bei einem seiner holländischen Freunde geliehen hatte: ‘Das Buch Hiob’, eine Prachtausgabe, herausgegeben und illustriert von William Blake, dem englischen Dichter und Maler aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts, von dem ich schon mehrmals gehört hatte, ohne je eines seiner Werke gesehen zu haben. Die englischen Illustratoren des ausgehenden 19. Jahrhunderts brachten seinem seltsamen Genie, seiner medialen und visionären Natur, die aus Träumen und bedrückenden Schreckbildern und Halluzinationen schöpfte, höchste Schätzung entgegen. Vermeylen hatte noch keinen Namen für das Kind seiner Sorgen und Hoffnungen gefunden. Der inhaltliche Umkreis der Zeitschrift war von ihm und seinen Mitarbeitern noch nicht festgelegt worden. Der Titel einer | |
[pagina 63]
| |
Sammlung von Kritiken von Charles Morice hatte Vermeylen fasziniert: ‘La littérature de tout à l'heure’ (Die Literatur von heute). Es war klar, daß dieser Name für das Programm paßte, das sich Vermeylen und seine Freunde vorgenommen hatten. Aber war das Programm der Bewegung ausschließlich literarisch, wie die Mitarbeiter es glaubten? ‘Für uns junge flämische Literaten’, bemerkte Vermeylen, ‘ist die Literatur aufs engste mit der ‘Flämischen Bewegung’ verbunden, die ihrerseits ebenso eng mit der politischen Emanzipation wie mit dem sozialen Aufstieg Flanderns zusammenhängt.’ Er sah in der Menschlichkeit einer völlig freien Gemeinschaft die einzige Möglichkeit für die Entfaltung des Individuums und für eine unabhängige Kunst. ‘De Vrije Kunst!’ - dieser Titel hatte ihn gelockt. ‘Eine freie Kunst’, fuhr ich fort, ‘ist an keine Grenzen gebunden, es seien denn die Grenzen des Talents oder des Ausdrucks der künstlerischen Persönlichkeit.’ Damals, als Vermeylen und ich solche Gedanken austauschten, diskutierten Künstler und Soziologen leidenschaftlich die Zukunftsfragen der Kunst. Die Anhänger des Prinzips ‘L'art pour l'art’ standen in Opposition zu den Verteidigern des Gedankens ‘die Kunst für das Volk’, also einer ‘sozialen Kunst’. Die Diskussionen kreisten um die Fragen der ‘Zeitgenossenschaft’, des pointiert Aktuellen. ‘Van nu en straks’ (Von heute auf morgen) - diese Worte sprach Vermeylen immer wieder vor sich hin, ohne daß ich mir bewußt wurde, daß sie der Titel seiner Zeitschrift werden sollten. All dies ereignete sich an einem Nachmittag in Calmpthout im Sommer 1892. Die erste Nummer der ersten Avantgarde-Zeitschrift flämischer Sprache erschien am 1. April 1893. Für das Titelblatt entwarf ich eine dekorative Komposition, bei der die Lettern des Titels in ein freies, aggressives Linienspiel eingefügt sind. Die Initialen, Vignetten und Zierleisten schlossen sich der ornamentalen Ausdrucksweise an, die ich als erster für den Umschlag der Gedichtsammlung ‘Dominical’ von Max Elskamp verwendet hatte. In einem viele Jahre später erschienenen Essay ‘De Gezelle à aujourd'hui’ schrieb Vermeylen mit jener ihm eigenen freundlichen Ironie: ‘Da wir wünschten, daß alles sich in Harmonie abspiele, hatte van de Velde die Buchstaben des Titels in Schwung gebracht. Sie waren, schwer entzifferbar, in ein welliges Liniengefüge eingefügt, das unser Programm symbolisierte. | |
[pagina 64]
| |
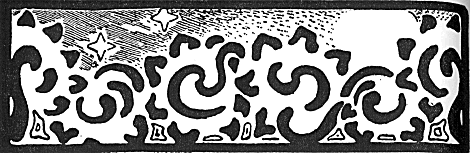
20 Querleiste van de Veldes zu ‘Van nu en straks’, 1893
Das Publikum mit seiner Rhinozeroshaut begriff natürlich nichts. Aber wir, die wir es ernst meinten, erfaßten den Sinn. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob wir alle das gleiche meinten.’ | |
Die ‘Engelswache’Meine Gesundheit war immer noch erschüttert, und trotz der Gartenarbeit im Park von ‘Vogelenzang’ blieb ich immer in Gefahr, neurasthenisch zu werden. Unter günstigeren Umständen hätte ich leichter den Weg gefunden, mein Leben und meine Ziele mit meinen Fähigkeiten in Einklang zu bringen und den Radius meiner Aktivität auszudehnen. Mein Freund, der Maler Willy Finch, der früheste Anhänger des Impressionismus in Belgien, hatte zu jener Zeit die Malerei aufgegeben, um sich ausschließlich der Töpferei zu widmen. Finch hatte die gleichen Konflikte wie ich durchgemacht; aber er hatte Halt an den Theorien von Ruskin und Morris gefunden. Er war in Belgien geboren, jedoch englischer Abstammung. Daher kannte er die Erneuerungsbestrebungen innerhalb der modernen englischen Architektur und des Kunstgewerbes. Doch bevor ich in die Gedanken und Theorien von Ruskin und Morris, die später meine Entwicklung entscheidend bestimmten, tiefer eindringen konnte, haben zwei Ereignisse dazu beigetragen, mich aus der gefährlichen Sackgasse heraus- und meinem Schicksal entgegenzuführen. | |
[pagina 65]
| |
Wenn ich früher gesagt habe, die Pinsel seien meiner Hand entglitten, so darf man dies nicht allzu wörtlich auffassen. In den Jahren der Depression bemühte ich mich immer wieder, sie erneut aufzunehmen. Sobald ich mich besser fühlte, suchte ich auf der Leinwand festzuhalten, was mich der Garten von Calmpthout über die Kraft lehrte, mit der die Natur die armen Lebewesen tröstet und stärkt; wie sie ihnen mit den schützenden Gebärden der Bäume hilft, mit den Blumen, die wie fromme Schwestern während unsres Leidens freundlich lächeln. Zwei oder drei Landschaften und einige Pastelle stammen aus jener Zeit. Aber der Mangel an tieferer Überzeugung und die fehlende innere Glut ließen mich zweifeln und schwächten meinen Arbeitseifer. Einige Bildthemen, die sich auf mein früheres Leben bezogen und die mich besonders beschäftigt hatten, stiegen immer wieder vor mir auf. Eines dieser Themen schien über meine Ohnmacht und Schwäche zu siegen. Während der langen Stunden, die ich mit meiner Mutter unter den Obstbäumen von Wechel der Zande verbrachte, hatte ich mich mit der Komposition eines Bildes beschäftigt, das eine ‘Engelswache’ darstellen sollte. Vier kniende Mädchen wachten mit gefalteten Händen über den Schlaf des auf dem saftigen Rasen eines Obstgartens gebetteten Gotteskindes. Diese Mädchen sollten durch nichts, weder durch ihre Bekleidung noch durch irgendein anderes Attribut, erkennen lassen, ‘daß sie Engel waren’. Sie sollten die Kleider der Erstkommunikanten tragen, als Hinweis auf ihre Unschuld und absolute Reinheit. In den flämischen Dörfern tragen die Erstkommunikanten keine weißen Kleider wie in den großen Städten, sondern es werden Stoffe in lebhaften Farben bevorzugt. Ich hatte mir vier rotgekleidete Mädchen ausgedacht. Die verschiedenen roten Töne - vom tiefen Amarant bis zum glänzendsten Karmesin - waren mit Hilfe von großen, flächenhaften Lokalfarben verwirklicht; die durch das Blattwerk schillernden Sonnenflecke bewirkten ein Spiel, das durch die lebhaften und gewagten Töne des grünen Rasenteppichs noch verstärkt wurde. Ich hatte damals eine Vorliebe für solche ‘Motive’ der Lichtdurchdringung und ihre mosaikartige technische Ausführung, welche ich der Pracht und dem Reichtum von Orientteppichen anzunähern trachtete. Das Verfahren der neo-impressionistischen Farbteilung mit seiner Gegenüberstellung von Farbpunkten schien mir für solche Wirkungen besonders ge- | |
[pagina 66]
| |
eignet. Dank den in Wechel der Zande gemachten Plänen und Skizzen für dieses Bild glückte mir die Fixierung der ganzen Komposition auf eine Leinwand großen Formates. Aber nach dieser Anstrengung verlor ich von neuem den Mut. In meiner tiefen Verzweiflung stieg die Erinnerung an die Augenblicke der Begeisterung, ja des Rausches empor, die ich erlebte, als vor mir die Berufung erschien, an der ich jetzt so sehr zweifelte. Es war angesichts zweier berühmter Bilder Manets: ‘Le Bar aux Folies Bergère’ und des ‘Porträts des Baritons Faure in der Rolle Hamlets’, die in einer der Triennale-Ausstellungen in Antwerpen zu sehen waren. Heute noch, nach so vielen Jahrzehnten, könnte ich die Stelle zeigen, wo damals die beiden Bilder in den großen Sälen der Rue Vénus hingen. Mit verbundenen Augen spüre ich noch immer die Strahlungskraft der beiden Wunderwerke, in denen das Leben sprühte. Dort erlebte ich das Wunder der Malerei.
Schon mehrmals hatte ich geplant, ein Handwerk zu erlernen, am liebsten ein Kunsthandwerk. Doch erst vor der großen Skizze der ‘Engelswache’ und im Augenblick meines Zweifels an der Möglichkeit ihrer Ausführung kam mir der Gedanke, durch eine Kunststickerei zu verwirklichen, was ich nicht mehr durch Malerei verwirklichen zu können glaubte. Meine Schwester und eine ihrer Freundinnen sammelten die Stoffe und Seidenstücke, die ich für die Herstellung einer Broderie benützen wollte. Aber ich machte mir bald klar, daß ich allein und ohne die elementaren technischen Kenntnisse dieses Handwerks nicht zum Ziel gelangen konnte. Beim Auftreten der ersten Schwierigkeiten wendete ich mich an eine meiner Tanten, die in der Werkstatt ihres Vaters an den bedeutendsten Broderien mitgearbeitet hatte, mit denen er als angesehener Meister der Stickerei in Gent Kirchen beliefert hatte. Sie erklärte sich um so lieber bereit, mir zu helfen, als sie in meinem, ihr etwas zweifelhaften Unternehmen ein Mittel sah, mich an sich zu binden. So begab ich mich Mitte Oktober 1892 nach langem Aufenthalt in Calmpthout nach Knokke-sur-Mer. Mein Onkel, ein alter Seebär, hatte sich nach langer, glücklicher Laufbahn als Kapitän in ein Haus zurückgezogen, das er in den Dünen am Meer hatte erbauen lassen. In den Zeiten der großen Segler und der Abenteuer hatte er sich ein kleines Vermögen erworben. | |
[pagina 67]
| |
Mit emsiger, geradezu klösterlicher Arbeit beschäftigt, verbrachte ich den Winter 1892/93. Sie forderte von mir nur wenig Phantasie; die Kartonskizze hatte die Einzelheiten der Stoffe und der seidenen Stickereifäden endgültig festgelegt. Für die Ausführung hatten wir uns zu dem einfachsten Verfahren entschlossen: für die Applikationstechnik. Es handelte sich im Grunde mehr um eine ‘Tapisserie’ als um eine ‘Broderie’. Als erfahrene Stickerin stellte meine Tante diese Tatsache mit ziemlicher Geringschätzung fest. Ihr Interesse für die gemeinsame Arbeit belebte sich jedoch mehr und mehr, als sie erkannte, in welchem Maße die wissenschaftliche Farbtheorie und die Gesetze der Komplementärfarben zu neuen Möglichkeiten bei der Gegenüberstellung der Flächen führten, mit denen die ganze Tapisserie ähnlich wie die Glasgemälde aus einzelnen Glasstücken ‘mosaiziert’ wurde. Wie die Glasgemälde mit Verbleiungen, so mußten die verschiedenfarbigen Stoffe mit Seidenfäden eingefaßt werden, die wie Borten mit Punkten in gleichen Abständen fixiert waren. Auf diese Einfassungen wandte ich die Prinzipien der wissenschaftlichen Farbtheorie an: ‘Jede Farbgruppe, die von der Sonne beleuchtet ist, hängt mit dem Orange zusammen, das vom Licht des Gestirns ausgesendet wird; jede im Schatten liegende Farbgruppe wird in Kontrastwirkung vom Blau bestimmt.’ Die Anwendung dieses Grundgesetzes bestimmte die Wahl der ersten seidenen Konturen, deren Breite mit der Größe der Flächen in Beziehung stand, die sie umschrieben. Das gleiche galt für die zweiten Konturen, die die ersten ergänzten und ihnen genau folgten. Durch diese sich ergänzenden Konturen erhielt die Tapisserie eine beträchtliche Pracht. Wir saßen uns am horizontalen Arbeitstisch im Atelier des Hauses in Knokke gegenüber vor dem großen Fenster, durch das unser Blick auf die unendliche Weite des Meeres glitt, und wir, meine Tante und ich, konnten uns vorstellen, daß wir auf einem Schiff in ferne Länder reisten. Während der langen Wochen der Arbeit an der Tapisserie-Broderie schweiften meine Gedanken in weite, unbekannte Fernen, und ich fragte mich, wohin das Schicksal mich führen würde. Es herrschte fast immer undurchdringlicher Nebel. Das ununterbrochene Rauschen des Meeres näherte und entfernte sich mit Flut und Ebbe. Nur an Tagen des Frostes breitete sich das Meer in stillem Glanz aus. An sol- | |
[pagina 68]
| |
chen Tagen stieg ich mit Zeichenblock und Pastellstiften zum Strand hinab, um die linearen Arabesken aufzuzeichnen, die die zurückflutenden Wellen im Sand hinterließen. In den Dünen bei Knokke hatten mich schon früher ähnliche Bildungen fasziniert: vergängliche, eigenwillige, raffinierte abstrakte Ornamente, die der Wind in den Sand zeichnete. Auch als ich die Malerei aufgegeben hatte, verließ mich der Dämon der Linie nicht, und als ich die ersten Ornamente schuf, entstanden sie aus dem dynamischen Spiel ihrer elementaren Kräfte. Im Katalog des Salons der ‘Vingt’ vom Jahre 1893, des letzten dieser berühmten Vereinigung, begleitete eine erklärende Notiz mein Werk. Ich erwartete von ihr eine beruhigende Wirkung auf das Publikum, da ich negative Auswirkungen der Primitivität der Technik, des Archaismus der Zeichnung und der rhythmischen Bewegung meiner Komposition befürchtete. Die Notiz entstammte dem ‘Livre des Métiers’ (dem Werkbuch) des Etienne Boileau, des Vorstehers der Pariser Kaufleute in den Jahren 1258 bis 1268: ‘Wenn aber der Geselle nicht Sohn eines Meisters war, verlangte man vor seiner Bestallung als ‘Meistersticker’ von ihm eine Darstellung einer Gruppe von mehreren Personen.’ Meine Broderie entsprach diesen Forderungen; ich hatte ein Beweisstück. Dieser Hinweis machte deutlich, welche Veränderung sich in mir vollzogen hatte. Deutlicher konnte ich nicht erklären, daß ich mich als Kunsthandwerker betrachtete und daß ich von nun an als solcher betrachtet zu werden wünschte. Das zweite Ereignis, das ebenso stark dazu beitrug, daß ich meinen Beruf wechselte, war das Zusammentreffen mit dem Wesen, das später meine Frau werden sollte. | |
Begegnungen mit Mallarmé und VerlaineMallarmés Besuch schenkte uns unvergeßliche Eindrücke. Er sprach im Februar 1890 im Kreis der ‘Vingt’ in Brüssel über Villiers de l'Isle-Adam, der am 19. August des Vorjahres gestorben war. Die Vortragstournee führte Mallarmé auch nach Antwerpen. Selbst die unvorbereiteten Zuhörer, die anfänglich Verständigungsschwierigkeiten hatten, erlagen nach kurzer Zeit | |
[pagina 69]
| |
dem Charme seiner zauberischen Sprache und der vollendeten Eleganz des Vortrags. Ein unwiderstehliches Fluidum strömte aus seinen Worten. Souverän und offenbar in vollem Bewußtsein der Schwerverständlichkeit seiner Gedanken überwältigte der Dichter die Anwesenden. Emile Verhaeren, der Freund der meisten Teilnehmer an den Vorträgen und Ausstellungen der ‘Vingt’, schrieb in der Zeitschrift ‘L'Art Moderne’ über den denkwürdigen Abend, daß er für viele Teilnehmer ‘auf immer zu den höchsten Erinnerungen zählen würde, der ‘gesprochene Traum’, der geheimnisvoll wie Glaubensworte bisweilen in Ekstase überging, die den großen Toten Villiers de l'Isle-Adam bald als Geist, bald in irdischer Gestalt, ebenso unsichtbar wie stets gegenwärtig beschwor’. Von jenen aber, denen die Worte des Redners unverständlich geblieben waren, hatte ich den Eindruck, sie verließen den Saal andächtig und bewegt wie Gläubige, die nie in Versuchung geraten waren, an ihrem Glauben zu zweifeln oder in den tieferen Sinn der religiösen Zeremonien und Gesänge einzudringen. Die Vortragsreise, die Mallarmé in die literarischen Zirkel einiger belgischer Städte führte, sah als zweite Station Antwerpen vor. Octave Maus hatte mich gebeten, den Dichter zu begleiten und ihm in Antwerpen als Führer zu dienen. Im Zug waren wir in einem Coupé mit nur zwei Plätzen untergebracht, wie sie damals an beiden Enden der Wagen erster Klasse zu finden waren. Mallarmé begann zu sprechen und fragte nach einigen in Brüssel neugewonnenen Freunden, deren Namen er orthographisch richtig notieren wollte. Dann stand er plötzlich auf und lehnte sich gegen die Tür des Ganges. Es begann ein Monolog, von dem ich nicht mehr weiß, wie er anfing, und der erst endete, als der Zug in Antwerpen hielt. Ton und Rede erreichten sogleich das Niveau einer improvisierten Vorlesung oder einer geschriebenen Abhandlung. Ein zufällig gefallenes Wort wurde zum Thema. Kurze Sätze stießen auf Grund geheimnisvoller Impulse in verschiedene Richtungen vor, wie um den Umkreis und die Grenzen des Themas zu erkunden, und kehrten, auf das Wesentliche reduziert, zurück. Zu wenigen Worten knapp zusammengefaßte Formeln wurden in ein einziges Wort gepreßt, dessen Glanz etwas Irreales und dessen Sinn etwas von magischer Ewigkeit angenommen hatte. Während der ganzen Reise stand ich hingerissen im Bann dieses wunderbaren Erlebnisses. | |
[pagina 70]
| |
Das Anfangswort ‘Encre’ (Tinte) hatte als Sprungbrett und Rakete zugleich gedient. Mallarmé gelangte in schwindelndem Aufstieg zu einer überraschenden Definition des ‘geschriebenen Buchstabens’ und des ‘gedruckten Wortes’; er setzte beides der Kunst des Komponierens und der literarischen Schöpfung gleich. Ich hatte in diesem Augenblick das Gefühl, mich an der Quelle zu befinden, aus der Mallarmé die Kraft zur Wiedergeburt von Gedanke und poetischer Form schöpfte, die der Meistermagier mit stolzester Gleichgültigkeit gegen Verständnis oder Unverständnis vollzog. Ein solcher Monolog hatte etwas von einem Wunder. Es erneuerte sich an jedem jener berühmten ‘Donnerstage’ Mallarmés, denen die bedeutendsten Vertreter der französischen und ausländischen Literatur in einer Atmosphäre der Verehrung beiwohnten, die älteren Dichter des ‘Parnass’ und die jüngeren, erst vor kurzem anerkannten Symbolisten. Ich hatte das Glück gehabt, zwei- oder dreimal im kleinen Salon der bescheidenen Wohnung Mallarmés in der Rue de Rome in Paris solchen ‘Zeremonien’ beizuwohnen. Mallarmé improvisierte. Er stand in ähnlicher Haltung, wie sie mich im Coupé auf der Reise von Brüssel nach Antwerpen so tief beeindruckt hatte, mit dem Rücken gegen den offenen Kamin, in dem ein Scheit brannte. Mallarmé befand sich in Antwerpen, Gent, Brügge und Lüttich vor einem Publikum, das unfähig war, ihn zu verstehen und zwischen geheimnisvoller Sprache oder Mystifikation zu unterscheiden. Sehr viel später, bei meinem letzten Besuch bei ihm in Paris, erinnerte Mallarmé sich an zwei Eindrücke, die er bei seinem kurzen Aufenthalt in Antwerpen empfangen hatte: an den Spaß, den ihm die Feststellung machte, daß die meisten Hafenarbeiterinnen, die robusten Fischverkäuferinnen und die appetitlichen jungen Frauen in den Gassen des Hafenquartiers Strümpfe von einem zarten, warmen Rosa trugen, das an das Fleisch der Akte und Frauenporträts von Rubens erinnerte. Die zweite Erinnerung bezog sich auf den tiefen Eindruck, den er im ‘van Ertborn-Saal’ des Museums empfangen hatte. In stummer Andacht hatte er die Bildtafeln der primitiven flämischen und deutschen Maler bewundert. Zwei kleine Bilder, eine ‘Heilige Barbara’ von van Eyck und eine ‘Eva’ von Cranach, ergriffen ihn so sehr, daß er diesmal Worte brauchte, um uns seine Bewegung auszudrücken. Der weite, majestätische Falten- | |
[pagina 71]
| |
wurf der vor einem Turm sitzenden Heiligen, den fleißige Arbeiter ihr zu Ehren errichteten, schien ihm so geschickt angeordnet, daß er als festes Fundament das ganze Gewicht des Turmes tragen konnte. Das zauberhafte Ebenmaß des kaum entwickelten Körpers der ‘Eva’ Cranachs, die Einheit der Farbtöne, das Elfenbein, mit dem sich der Körper der kleinen Gestalt vom schwarzen Hintergrund abhob - ließ das nicht an irgendeine Verwandtschaft der Vision des alten deutschen Malers mit Utamaro oder mit einem der anderen Meister der japanischen Holzschnitte denken? Der Leser möge nicht Mallarmé, sondern mir die aus der Erinnerung zurückgerufene, ungeschickte Ausdrucksweise zuschreiben. Im Jahre 1893 hatte ich eine wesentlich schwierigere Aufgabe zu erfüllen als bei Mallarmés Aufenthalt. Es war Octave Maus gelungen, Paul Verlaine für eine Anzahl Vorträge in Belgien zu gewinnen; einige literarische Ver- 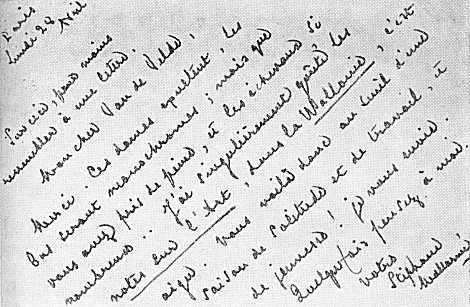
21 Postkarte Stéphane Mallarmés vom 28. April 1890
| |
[pagina 72]
| |
einigungen hatten sich bereit erklärt, den ‘Armen Lelian’ vor ihren Mitgliedern sprechen zu lassen. Solche Vorträge waren abenteuerlich vor einem Publikum, das gewohnt war, Gelehrte oder Dichter im Frack auf dem Podium vor sich zu sehen. Einer der Präsidenten einer literarischen Vereinigung hatte gesagt, es sei ein gewagtes Unternehmen, ‘ein solch seltsames Tier in Freiheit vorzuführen!’ Bei den ‘Vingt’ mußte man sich nicht beunruhigen. Das Publikum der ‘Vingt’ hatte gelernt, Unabhängigkeit, Absonderlichkeit und im Fall Verlaines Armut zu respektieren; auch der bejammernswerte Zustand des Anzugs, in dem der berühmte Dichter in Brüssel angekommen war, wurde als selbstverständlich hingenommen. Seine äußere Erscheinung wirkte so, daß die Anwesenden aufs tiefste ergriffen waren; die einen aus spontanem Erbarmen, die anderen aus Empörung gegen die Ungerechtigkeit des Schicksals und die Gleichgültigkeit einer Nation, die längst hätte die Mittel finden müssen, einem ihrer ruhmreichen Söhne wenigstens ein Existenzminimum zu garantieren. Keiner hat das Auftreten Verlaines bei den ‘Vingt’ besser beschrieben als Emile Verhaeren: ‘Linkisch, unkonventionell gekleidet, auf einen Stock gestützt, sahen wir ihn, den Dichter, das Podium betreten. Mit sachlicher Stimme, als lese er nur für sich selbst, sprach er über Kunst und Vers. Bei den ‘Vingt’ war man sich des Respektes bewußt, den man ihm schuldete, und obwohl er kaum zu verstehen war, hütete man sich, es ihn merken zu lassen. Wer hätte bei einer solchen Vorlesung, bei der der Dichter mit Tränen in den Augen seine Irrtümer bekannte, nicht gefühlt, welche Kränkung es bedeutet hätte, ihm die Aufmerksamkeit zu verweigern? Er kommt aus dem Mittelalter; er besitzt dessen Glauben und dessen Zügellosigkeit.’ Ich hatte Sorgen wegen Verlaines Auftreten in Antwerpen. Vor allem mußte er bessere Kleider haben. Mit Max Elskamp hatte ich verabredet, - bevor wir Verlaine zu meinem Vater brachten, wo er während seines Aufenthaltes in Antwerpen wohnen sollte -, in einem Hemden- und einem Schuhgeschäft vorbeizugehen. Im übrigen würde uns der Kleiderschrank meines Vaters helfen. Als dann Verlaine in einem Anzug meines Vaters aus seinem Zimmer kam, um sich zum Vortrag zu begeben, waren wir sehr erleichtert. Welch ein Gegensatz zwischen dem ‘Armen Lelian’ gestern in Brüssel und dem würdigen Greis von heute! Der Präsident des Antwerpener Kunst- | |
[pagina *9]
| |

22 Henry van de Velde: Garten in Calmpthout, um 1891
| |
[pagina *10]
| |

23 Henry van de Velde: Lesende Frau, Pastell, um 1892
| |
[pagina *11]
| |
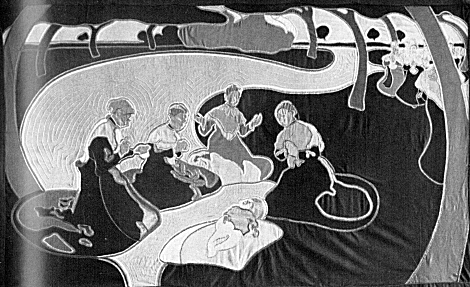
24 Henry van de Velde: Engelswache, Tapisserie, 1892/93
| |
[pagina *12]
| |

25/26 Ausstellung ‘Art Nouveau’ bei S. Bing, Paris, Ende 1895. Speise- und Rauchzimmer
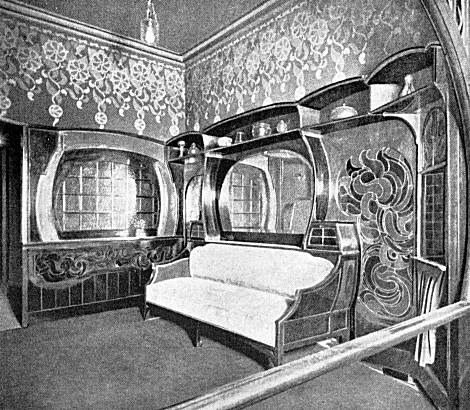 | |
[pagina 73]
| |
zirkels sprach einige Worte und bereitete das Publikum auf die chronische Stimmlosigkeit des Dichters vor. Wenn die Zuhörer auch wenig Verständnis für die symbolistischen Gedichte und für die Bemerkungen zur neuen poetischen Metrik zeigten, so genossen sie es doch sichtlich, Verlaine seine Gedichte selbst vortragen zu hören. Später führten wir ihn in eine Taverne der Rue de Keyzer, wo ihn einige Künstler und Freunde unserer ‘Association pour l'art indépendant’ erwarteten. Der Empfang, der ihm an jenem denkwürdigen Abend bereitet wurde, und die Herzlichkeit der ihm zugedachten Ehrungen gingen dem gebrechlichen, vorzeitig von hartem Schicksal gebeugten, aber von Unsterblichkeit umstrahlten Mann, der die französische Sprache mit so viel herrlichen Gedichten beschenkt hat, sichtlich zu Herzen. Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, das man ihm ins Zimmer gebracht hatte, klopfte ich an seine Tür. Verlaine stand am Fenster. Er betrachtete die Kaffee-Verleserinnen im Packhof gegenüber unserem Hause und beobachtete die mächtigen Lastwagen und schweren flämischen Pferde, Verwandte der französischen Rosse aus dem Departement Perche. Kaffeeballen wurden hinaufgehoben und durch kräftige Hände nach innen gezogen. Die Kaffee-Verleserinnen haben von allen Antwerpener Hafenarbeiterinnen die traditionellen Kleider und Haartrachten ihrer iberischen Vorfahren am treuesten beibehalten. Sie zeigen unverkennbar ihre Herkunft von der spanischen Besatzung der nordflandrischen Provinzen. Verlaines Entzücken über die Arbeiterinnen mit ihren goldenen Ohrringen und den ‘Fliegen’ auf den geschminkten Wangen verwandelte sich in Ekstase, als uns auf unserem Weg an einer Straßenecke ein Leichenzug den Weg versperrte. Schwarze Pferde, bedeckt mit silberdurchwirkten Tüchern, zogen den enormen, blumengeschmückten Leichenwagen. An den vier Ecken des Gefährts hielten vier vergoldete Holzengel mächtige Lampen und trugen auf ihren Flügeln das ganze Gewicht der Wölbung des fahrenden Katafalks. Verlaine war überwältigt stehengeblieben. Wir hörten, wie er eine Folge unverständlicher Worte psalmodierte. Unser Weg durchs ‘Schippers Kwartier’ brachte ihm noch andere Überraschungen. Max Elskamp hatte die Rolle des Führers übernommen. Unterwegs machte er uns mit den Entdeckungen bekannt, bei denen er alles sammelte, was an Folklore im Hafenquartier zu finden war, die einen Teil | |
[pagina 74]
| |
der reichen Volkskunst unsrer flämischen Provinzen bildete. Er stöberte bei den Trödlern, ging in Wirtshäuser und Seemannskneipen und kaufte auf, was ihm verdächtige Individuen zutrugen, die ihn für einen Narren hielten. Was er bei diesen Fischzügen erwarb, bildete den Grundstock der Sammlung, die Max später Antwerpen schenkte. Die Stadt brachte sie in einem Haus neben dem Musée Plantin unter, und Antwerpen besaß damit das erste Volkskunstmuseum Belgiens. Um die Mittagszeit überquerten wir die Schelde auf einem der großen Raddampfer, die den Pendelverkehr zwischen der Stadt und dem Dorf St. Anne besorgen. Von dem Dutzend Häuser des Fleckens war die Hälfte Wirtshäuser, in denen man die Antwerpener Spezialitäten ‘moules et pommes frites’ und ‘anguilles au vert’ angeboten erhielt. Verlaine schien sie nicht besonders zu schätzen und äußerte deutlich seine Abneigung gegen das schwere flämische Bier. Einige Gläser Chablis und Burgunder, die Max und ich mit mehr Kennerschaft genossen als unser Gast, brachten das Ge-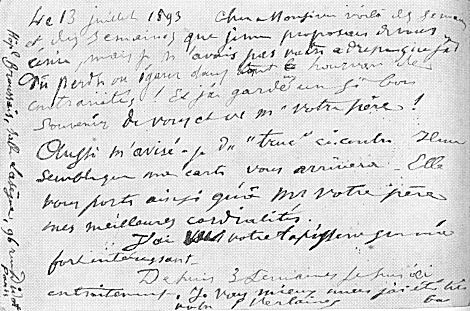
27 Postkarte Paul Verlaines vom 13. Juli 1893
| |
[pagina 75]
| |
spräch auf das Panorama und die Atmosphäre Londons im Vergleich zur Reede und zum Hafenleben Antwerpens. Beim Kaffee gestand Verlaine, in Paris manchmal Heimweh nach Hafen und Meer zu haben, wo ‘er sein Schiff von Quai zu Quai lenkte angesichts eines baldigen, immer aufgeschobenen Aufbruchs’. Ob bei Verlaine in diesem Augenblick wohl Erinnerungen an die mit Rimbaud in London verbrachte Zeit wiedererwacht waren? Wir kehrten rechtzeitig nach Antwerpen zurück. Verlaine hatte Zeit, sich auszuruhen, bis wir ihn im Wagen zum Bahnhof brachten, wo er den Zug nach Brüssel nahm. Dort sprach er am gleichen Abend vor der intellektuellen katholischen Jugend, die sich nicht scheute, das Werk des ‘reuigen Sünders’ zu bewundern und ihm gelegentlich materielle Hilfe zu gewähren. Nach seiner Rückkehr nach Paris sandte Verlaine mir eine Postkarte, deren summarische Adresse lautete: M. Henry van de Velde, chez son père, Quartier anglais, Anvers. |
|

