Geschichte meines Lebens
(1962)–Henry Van de Velde–
[pagina 22]
| |
Zweites kapitel
| |
[pagina 23]
| |
miert hatte - kurz, er erkundigte sich, wohin ich so regelmäßig ginge und von wo ich so pünktlich zurückkehrte. Ich ließ ihn wissen, womit ich den Tag verbrachte, und erklärte meinen Entschluß, Maler zu werden. Und überraschenderweise hörte mich mein Vater mit geradezu verwirrendem Wohlwollen an. Er fragte nach dem Lehrer, bei dem ich mich eingeschrieben hatte, und beschloß, dessen Meinung einzuholen. Alles verlief so ruhig, daß ich annehmen möchte, mein Vater wußte mehr, als er zugab. Da ich die Akademie erst seit kurzem besuchte, wollte sich der Lehrer noch nicht endgültig äußern. Aber sein Urteil war nicht ungünstig. So wurde entschieden - vor allem auch auf Zureden meiner Mutter, die glücklich war, mich zu Hause behalten zu können -, daß ich den Unterricht weiter besuchen dürfte, bis endgültig über meine Zukunft entschieden würde. Von diesem Augenblick an wurde ich ein eifriger Schüler der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen. Ich durchlief verschiedene Klassen: Allgemeines Zeichnen, Zeichnen nach antiken Vorbildern, nach lebendem Modell und schließlich eine Malklasse. Nach einiger Zeit veranlaßte mich der Direktor der Akademie, der Tiermaler Charles Verlat, meine Studien in seinem privaten Atelier fortzusetzen. Ich nahm die Aufforderung um so lieber an, als mir die Arbeit in den trübseligen Ateliers der Akademie verhaßt geworden war und die Gefahr bestand, daß dieser Haß schließlich meine Freude an der Malerei und meinen Arbeitseifer vernichtet hätte. In Verlats großem Atelier im Stadtteil St. André hoffte ich einen besseren Lehrer zu finden als im Lehrkörper der Akademie, der seit Bestehen des Institutes nie ein tieferes Niveau aufgewiesen hatte. Kann man sich heute noch vorstellen, daß Landschaftsmalerei in einem Atelier gelehrt wurde, in dem vertrocknete, in den Sand gesteckte Bäume verschiedener Gattung je nach Jahreszeit mit grünen oder gelben Blättern behängt wurden? Für Winterlandschaften wurden Wattebäusche an die Zweige gehängt und Gips auf den Boden gestreut! Wird man mir glauben, wenn ich von der Lehre berichte, die ein Professor seinem Schüler gab, der es gewagt hatte, im Freien zu malen, auf einer richtigen Wiese, unter dem wirklichen Himmel? Schüchtern hatte der Schüler der Hecke und den Schatten auf dem Rasen einen violetten Ton gegeben. ‘Wenn Sie sich die Mühe gegeben hätten, genau hinzusehen, so hätten Sie, bei Gott, bemerkt, daß | |
[pagina 24]
| |
sich bis heute nichts an der Weltordnung geändert hat: die Hecken sind grün, und der Rasen ist unverändert grün. Nichts ist im Lauf der Zeiten anders geworden, auch nicht unter dem Einfluß irgendeiner Schule!’ Zu jener Zeit war man an den offiziellen Kunstschulen überzeugt, daß keine direkte Naturbeobachtung den Stil und die Palette eines Ruysdael oder Hobbema ändern könnte. Und doch hätte die Farbgebung van Goyens oder Vermeers das Dogma erschüttern müssen, das der Professor für Landschaftsmalerei so autoritär formulierte. Das Erlernen des Manuellen war das einzige Prinzip des Studienprogramms. ‘Lernt erst einmal das Handwerk’, wiederholten unsere Lehrer bei jeder Gelegenheit. Wir wollten schon. Aber was mich anging, so fühlte ich mich verwirrt durch die Untauglichkeit der Mittel, die man uns eintrichtern wollte, und durch die Mittelmäßigkeit der Professoren, die zwar das Handwerk beherrschten, aber nur jämmerliche Resultate erzielten. Im Jahr 1884 wurde zum ersten Male im Rahmen der alle drei Jahre stattfindenden Antwerpener Kunstausstellung ein Bild Edouard Manets: ‘Bar aux Folies Bergère’ gezeigt. Ich war tief betroffen. Ohne zu überlegen, wie schroff und ungelegen mein Vorschlag wirken mochte, tat ich meinem Vater die Offenbarung kund und meinen Wunsch, an den Ort zu gehen, wo diese künstlerische Revolution sich ereignet hatte. Das Echo der leidenschaftlichen Diskussionen, das jedes im ‘Salon’ zugelassene oder abgelehnte Werk Edouard Manets auslöste, erregte meinen Wunsch, mehr zu erfahren. Ich wollte Zeuge der künstlerischen Kämpfe sein, die damals das Pariser Publikum aufpeitschten.
Im Oktober des gleichen Jahres 1884 begleitete mich mein Vater nach Paris. Dort wollte ich meine Studien fortsetzen und meine Kenntnisse vervollständigen. Mehr als ein Jahr verbrachte ich in dieser Stadt, in der neue künstlerische Ideen lebendig wurden. Ich hatte mein einundzwanzigstes Lebensjahr erreicht und verfügte über einen monatlichen Betrag, der genügte, meinen Hunger in den kleinen Restaurants in der Nähe des Hôtel du Havre, meiner Wohnung, gegenüber der Gare Montparnasse zu stillen. Montparnasse war damals noch nicht das Viertel der jungen Bohème, der internationalen Snobs und der Welt der zweideutigen und exzentrischen Menschen, zu dem es 1918 wurde. | |
[pagina *1]
| |
 | |
[pagina *2]
| |

2 Henry van de Velde Bildnis des Vaters, 1884

3 Henry van de Velde Bildnis der Mutter, 1887
| |
[pagina *3]
| |

4 Henry Luytens: Eine Sitzung der Künstlervereinigung ‘Als ik kan’, 1886. Rückenfigur in der Mitte: Henry van de Velde
| |
[pagina *4]
| |
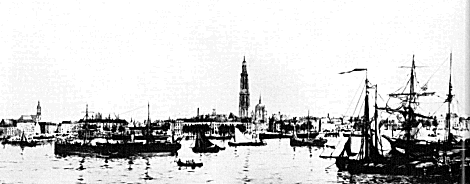
5 Hafen und Silhouette von Antwerpen. Radierung, um 1870

6 Henry van de Velde: Garbenfeld, im Hintergrund die Kirche von Wechel der Zande, 1887
| |
[pagina 25]
| |
Meine bescheidenen Mittel erlaubten mir, ein Atelier zu besuchen und mich anständig und sauber gekleidet bei Künstlern und in anderen Kreisen vorzustellen, für die ich Empfehlungsschreiben erhalten hatte. Eines dieser Schreiben sollte mir die Möglichkeit verschaffen, als Schüler bei Bastien-Lepage einzutreten, der rasch und mühelos einen hervorragenden Platz unter den Malern seiner Zeit erobert hatte. Meine Enttäuschung war groß, als ich erfuhr, daß das junge Haupt der Pleinair-Malerei erkrankt war. So griff ich auf einen anderen Brief zurück, den mir Peter Benoît mitgegeben hatte, ein Schreiben an den Maler Feyen-Perrin. Der alte Herr war insofern mit der Pleinair-Malerei verbunden, als er sein braves Talent der Darstellung von Szenen aus dem Fischerleben widmete. Er gehörte zu den unter dem Einfluß der Haager Schule stehenden französischen Malern. Feyen-Perrin empfing mich sehr freundlich und riet mir, den damals berühmtesten Pariser Porträtmaler, Carolus-Duran, aufzusuchen. Einer der Direktoren der Galerie Georges Petit übernahm es, die Verbindung mit dem Meister herzustellen, der sich bereit erklärte, mich zu empfangen. Carolus-Duran nahm mich als Schüler an. Daher verzichtete ich darauf, mich mit anderen Persönlichkeiten in Verbindung zu setzen, für die mir Peter Benoît Empfehlungsschreiben gegeben hatte. Ich versprach mir davon keine großen Vorteile und konnte mir nicht vorstellen, daß engere Beziehungen zwischen einem Anfänger wie mir und berühmten Künstlern wie dem Maler Meissonier oder dem Komponisten Charles Gounod entstehen könnten. Eine Eitelkeit, derer ich mich ein paar Jahre später geschämt hätte, bewog mich dann doch, die Schreiben Peter Benoîts an Ernest Meissonier und Charles Gounod zu benützen. Die Kunstliebhaber beider Hemisphären vergötterten zu jener Zeit Meissonier; vor seinem Ruhm verblaßte der Ruf aller anderen lebenden Maler. Ich war mir nicht klar, daß meine Absicht, den ‘Fürsten der Malerei’ aufzusuchen, sinnlos war. Geführt von einem livrierten Diener, stieg ich eine monumentale Treppe empor zur Etage, in der der Halbgott sich aufhielt, dem ich nichts zu sagen und den ich nichts zu fragen hatte. Als sich die riesigen Portale öffneten, sah ich den berühmten Greis vor einer Staffelei sitzen, die in der Mitte des übermäßig großen Ateliers stand. Auf der Staffelei befand sich eine winzig kleine Bildtafel. Ich war frappiert von der Zahl der kleinen Farbnäpfe auf dem Schemel | |
[pagina 26]
| |
neben der Staffelei und dem Mißverhältnis zwischen dem kleinen Bild und den Dimensionen eines Ateliers, das einem Rubens und seinen enormen Bildkompositionen entsprochen hätte. Es kam mir nicht in den Sinn, daß dieses Mißverhältnis nur mir auffiel, nicht aber jenen, die einem noch so kleinen Bild Meissoniers die gleiche Bedeutung beimaßen wie den großen Meisterwerken früherer Jahrhunderte. Meissonier blieb sitzen; ich verharrte stehend. Wir sprachen über Peter Benoît, und ich beantwortete seine Fragen über den von mir gewählten Lehrer. Ein anderer Gesprächsstoff interessierte ihn nicht, und so endete der Besuch. Von dem Bildchen war nicht gesprochen worden, und ich kann mich nicht erinnern, was es darstellte. Der Besuch hat nicht die geringste Bedeutung in meinem Leben gehabt, wenn nicht als eine Art Warnung, meinen künstlerischen Vorsätzen treu zu bleiben. Es waren weder Neugier noch Eitelkeit, die mich zu einem Besuch bei Charles Gounod, dem vom Opernpublikum der Welt vergötterten Komponisten, veranlaßten. Aber im Gegensatz zu Meissonier war sein Ruhm bedroht. Der Kampf im Reich der Malerei war noch weit davon entfernt, von Manet und den Impressionisten gewonnen zu werden; die Revolution Wagners dagegen hatte das Piedestal erschüttert, auf das der Komponist des ‘Faust’ erhoben worden war. Mit meinem Blick war ich Gounod gefolgt, als er während eines zu seinen Ehren veranstalteten Festivals in Antwerpen (1879) den vielen Proben beiwohnte. Seine Bescheidenheit und sein liebenswürdiges Auftreten hatten die Ausführenden für ihn gewonnen: die Musiker des Orchesters, den Chor und alle anderen, die irgendwie am Festival beteiligt waren. Mein lebhaftes musikalisches Interesse und der Charme, der von Gounods sanftem und freundlichem Wesen ausging, seine aus der Tiefe kommende musikalische Inspiration enthüllten mir die Tragödie der Komponisten vom Schlage Gounods, Verdis oder Meyerbeers, der berühmten Meister der ‘großen Oper’, die den Zusammenbruch dieser Kunstgattung unter der unwiderstehlichen Wucht des Wagnerschen Musikdramas erleben mußten. Ich war gewiß nicht der einzige, der von Gounod selbst erfahren wollte, was er befürchtete, was er im stillen erlitt und wie er die zukünftige Entwicklung beurteilte. Gounod war zu selbstbeherrscht, als daß er sich dem ‘ersten besten’ anvertraut hätte. Er war seiner Meisterschaft und der Wir- | |
[pagina 27]
| |
kung seiner Werke auf das Publikum so sicher, daß er keine Bitterkeit empfand. Als ich ihn nach meinem ersten Besuch verließ, fühlte ich keine Scheu oder Verlegenheit mehr. Charles Gounod hatte mich wie ein geistlicher Würdenträger empfangen, der den Höflichkeitsbesuch eines neuen Pfarrkindes entgegennimmt, mit dem er eine Gewissensfrage bespricht. Er versicherte, gern dem Sohn des Mannes behilflich zu sein, der ihn zusammen mit dem Publikum Antwerpens geehrt hatte. Mir indessen lag daran, sein Vertrauen zu gewinnen, um eines Tages seine geheimen Gedanken über das Genie Wagners und das Wunder von Bayreuth zu erfahren.
In Paris brach eine Cholera-Epidemie aus, was rasch in aller Welt bekannt wurde. Mein auf diesem Gebiet erfahrener Vater riet mir, die Stadt erst in dem Moment zu verlassen, in dem er mich zurückrufen würde. Die Ausländer in Paris wurden von einer Panik erfaßt. In dem von mir bewohnten Hôtel du Havre waren nur noch wenige Zimmer besetzt. Als einzige Vorsichtsmaßnahme empfahl mir mein Vater, mich aller Exzesse zu enthalten und mich zu zerstreuen. Exzesse konnte ich mir ohnehin nicht leisten, was Zerstreuungen betraf, so hatte ich noch keinerlei Erfahrungen. Belustigungen in der Art des ‘Bal Bullier’ kamen wegen meines Budgets nicht in Frage. Da entdeckte ich in Montrouge ein Vorstadttheater, in dem zwei- oder dreimal wöchentlich Operetten von Offenbach gespielt wurden. Hier fand ich die gewünschte billige Ablenkung, die kaum mehr kostete als der Eimer Kohlen und Holz, den der Hausknecht an den Abenden, die ich einsam zu Hause verbrachte, für das kleine Cheminée in meinem Zimmer brauchte. In einem Theater dieses Genres genießt man ebensosehr das Schauspiel im Parkett wie auf der Bühne. Das eine ist so amüsant wie das andere; manchmal bietet das Schauspiel im Parkett sogar mehr Überraschung und Abwechslung. Im Laufe meiner Besuche des Theaters von Montrouge lernte ich einige der Operetten Offenbachs kennen, deren Charme auch jeder Freund klassischer Musik genießen kann, ohne sich schämen zu müssen. ‘Hoffmanns Erzählungen’ geben einen Maßstab, was Offenbach hätte leisten können, wenn er nicht in der so oberflächlichen Zeit des Zweiten Kaiserreiches gelebt hätte. Ein dutzendmal ungefähr besuchte ich die Aufführung von | |
[pagina 28]
| |
‘Fortunios Lied’. Die Rolle des Fortunio spielte eine attraktive, in ihrer männlichen Verkleidung so aufrichtig verliebte Schauspielerin, daß jeder männliche Zuschauer ohne weiteres sich mit der Liebe und mit dem Kummer des jungen Helden identifizieren konnte. Eine Aufforderung der Familie de Bériot - Peter Benoît hatte mich an sie empfohlen -, ich sei ein stets willkommener Gast bei ihren Kammermusikabenden, die sie trotz der Cholera-Epidemie abhielten, war für mich eine willkommene Abwechslung zu den Offenbach-Aufführungen. De Bériot war der einzige Sohn der Malibran und des berühmten französischen Violinvirtuosen Charles Auguste de Bériot, der für sie das bezaubernde Haus an der Place d'Ixelles (Brüssel) hatte bauen lassen, das heute, vergrößert, in ein Rathaus umgewandelt worden ist. Ich kann nicht sagen, wie kostbar mir diese Abende während meines Pariser Aufenthaltes waren, wie sie mir geholfen haben und was für künstlerische Erfahrungen sie mir vermittelten: die Ergriffenheit, die befreit und den Menschen weit über sein irdisches Dasein ins Unwirkliche, Unendliche, Ewige erhebt. Nichts schien mir dem tiefen Genuß vergleichbar, dem Wunder der vier Instrumente eines Quartetts, die eine ganze Welt heraufbeschwören, in der sich die Töne begegnen, einander antworten, sich trennen und wieder vereinigen, zu einer Einheit verschmelzen oder Gedanken ausdrücken, die in Worten nicht faßbar sind. Heute noch sind mir die Empfindungen gegenwärtig, die mich damals beim Anhören der klassischen Quartette bewegten. Und wenn ich von diesen Abenden heimkehrte, an denen ich nicht die geringste Rolle gespielt habe außer der des aufmerksam und bescheiden gegen ein Fenster oder gegen eine Tür sich lehnenden jungen Mannes, war ich ‘so weit weg’, so erhoben in einen Zustand der Glückseligkeit, daß ich bis zur Erschöpfung die unendlichen Boulevards entlanglaufen konnte, die Neuilly mit dem Montparnasse verbinden. Ich nahm nicht einmal die Frauen wahr, die mich ansprachen und verlocken wollten, oder die ‘Bubus’, die mir wenig vertrauenerweckende Blicke zuwarfen. Die Epidemie ging glücklicherweise zu Ende, und ich erwartete Max Elskamp, der zu mir nach Paris kommen wollte. Vor seiner Abreise hatte er mir geschrieben, er habe alles für einen langen Aufenthalt vorbereitet. Ob er wohl in Paris, das ihn mächtig anzog, die notwendige Kraft und den Mut finden würde, um ‘dieser Unermeßlichkeit des Nichts’ standzuhalten? | |
[pagina 29]
| |
Würde er Wege finden, um der Schar der konventionellen Poeten auszuweichen? In überströmender Heiterkeit war er abgereist, mit respektlosen Versen auf den Lippen: ‘Gott, schläft man gut und sauft man gut,
Wenn endlich das Gewissen ruht,
Wenn man auf Jus und alle Richter scheißt
Und auch Gesetz für einen ‘merde’ nur heißt,
So wie der große Rabelais
Ein guter Monsieur Français.
Max kommt jetzt an,
Ein feiner Mann,
Feiner als ein Krammetsvieh
Bei seinem alten Freund Henry.
22. November 1884’
Er, der sich so heiter auf den Weg gemacht, der sich so viel von unserem gemeinsamen Leben versprochen hatte, kehrte zwei Wochen später nach Antwerpen zurück. In seinem ersten Brief nach seiner überstürzten Abreise erklärte er: ‘Ich bin selig, wieder daheim zu sein. Ich habe noch keinen Fuß vor die Tür gesetzt...’ Dieses Bekenntnis ist schmerzlich und aufschlußreich zugleich. Es enthüllt die geheime Neigung zur Zurückgezogenheit, in der Elskamp bis zu seinem Tod im gleichen Haus sein Leben verbrachte. Bei seinem Vater und seiner Schwester fand er den Schutz, den er in dem Pariser Hotel, wo er mich wiederfinden wollte, vermißte. Um die gleiche Zeit wurde am Kutschereingang des Hauses Boulevard Léopold, in dem er unterschlüpfte, ein Messingschild angebracht: Max Elskamp, Advokat. Während des Winters 1884/85 hatte ich in dem bescheidenen Hotelzimmer viele Abende über die Gefahr nachgedacht, die auch einen sehr begabten Künstler bedroht, der zu leicht oder zu rasch zu Erfolg gelangt. Ich zerbrach mir den Kopf über das Künstlerleben, das ich führen wollte. Das Beispiel derer, die den Ruhm mit Opfern und Entbehrungen erkauft hatten, übte eine starke Anziehung auf mich aus. Nur die Glücklichsten unter ihnen hatten - wie mir schien - gegen Ende ihres Lebens entsprechende praktische Befriedigung finden können. Inzwischen war mir klargeworden, daß der Unterricht Carolus-Durans für mich belanglos wurde. Er hatte sein Rezept, nach dem er unterrichtete, ohne sich allzuviel um die Persönlichkeit seiner zahlreichen Schüler | |
[pagina 30]
| |
zu kümmern. Den meisten fehlte übrigens gerade die Persönlichkeit! Seine sogenannten guten Schüler eigneten sich das Rezept schnell an. Sargent, Lavery und andere erreichten rasch ihren Lehrer und machten ihm sogar den Erfolg streitig. Ich konnte an die Brauchbarkeit solcher Rezepte nicht glauben. Carolus-Durans Rezept des Lokaltons, auf den Lichter und Schatten zu setzen seien, erweckte die Illusion von natürlicher Eleganz und ausdrucksvoller Vornehmheit. Aber das eine wie das andere ergab nichts als eine vorgetäuschte Lebendigkeit, durch die alles, was aus diesem Atelier hervorging, monoton erschien trotz allen Rückgriffs auf Velasquez oder Goya. Die Virtuosität des Pinselstrichs war das Gegenteil der wahren Empfindung, die in den Werken der großen Meister zum Ausdruck kommt. Carolus-Duran war jedoch zugleich klarblickend. Wenn er bei einem jungen Menschen, den er für begabt hielt, einen Mangel an Anpassungsfähigkeit oder Widerstand gegen sein Rezept bemerkte, gab er ihm freimütig den Rat, das Atelier am Boulevard Rochechouart zu verlassen, um allein zu arbeiten. Mir empfahl er nach einigen Monaten des Studiums in seinem Atelier, Manets Werke zu studieren, die damals verhöhnt oder mit äußerster Heftigkeit umstritten wurden, und meinen Weg allein zu suchen. Er meinte, ich solle in Paris bleiben oder in die Umgebung gehen, falls mich Landschaftsstudien in der freien Natur mehr interessierten. Außerdem würde der Besuch von Privatausstellungen meine unabhängige Arbeit gewiß fördern. Bei den offiziellen Empfängen, die er seiner zahlreichen Kundschaft gab, hielt er darauf, seine Schüler um sich zu sehen. Eine Prozession von Besuchern defilierte an diesen Tagen vor den neuesten Porträts des Meisters: bekannte Politiker, Mitglieder der französischen und ausländischen Aristokratie, Fürsten der Hochfinanz, amerikanische Industriekönige, die ihre Frauen und Töchter bei dem großen Maler porträtieren ließen. Zwischen der Haute Couture und dem Atelier Carolus-Durans verging ihr Tag. So lernte ich frühzeitig ein von Eitelkeit und Schmeichelei saturiertes Milieu kennen, dessen Hauptakteur von seinem Weltruf so überzeugt war, daß er einem amerikanischen Industriekönig, der seine Adresse notieren wollte, bescheiden sagte: ‘Schreiben Sie nur: Carolus-Duran, Europa.’ Ich sehnte mich immer mehr nach einem zurückgezogenen Leben auf | |
[pagina 31]
| |
dem Lande. Zu jener Zeit war das eindrucksvollste Beispiel für das Bild, das ich mir von einem Künstler und den ihm auferlegten Opfern machte, Jean-François Millet. Sein karges Leben und der Existenzkampf, den er in Barbizon für die Seinen geführt hatte, waren Gegenstand der Bewunderung und Verehrung aller jener Künstler, die sich vor seinem unerschütterlichen Willen verneigten, der dem Menschen das Bild des schwer arbeitenden Bauern vor Augen geführt hatte. Dem schalen Betrieb der Pariser Berühmtheiten war es diametral entgegengesetzt. Ich ging zu Carolus-Duran, um mich zu verabschieden und um ihm zu sagen, was mich bestimmte, nach Barbizon zu übersiedeln. Millet sollte mein Leitstern sein. Carolus-Duran gab einen neuen Beweis seines Weitblicks. Früher hatte er mir geraten, allein zu arbeiten und mich von den Werken Manets und der Impressionisten leiten zu lassen. Diesmal bestand er beim Abschied darauf, daß ich mir vor meiner Abreise in der Galerie Durand-Ruel eines der bedeutendsten Werke der französischen impressionistischen Schule anschauen sollte: die Gruppe der ‘Badenden’ von Renoir. Das Leben, das die jungen Maler in den primitiven Herbergen führten, ist in seiner Äußerlichkeit oft beschrieben worden. In Barbizon empfand ich es als eine Profanierung des heiligen Ortes, an dem ich etwas von den Eindrücken finden wollte, die Jean-François Millet zu den ergreifenden Werken des ‘Sämanns’, des ‘Mannes mit der Hacke’ oder der ‘Ährenleserinnen’ inspirierten. Das Edle der schlichten Gesten und Haltungen dieser einfachen Geschöpfe ist mit einer epischen Größe verbunden, die sich vom Eindruck der in den öffentlichen Sammlungen befindlichen Porträts von Königen und Würdenträgern und von den pathetischen Kompositionen der Modemaler aufs schärfste unterscheidet. Den falschen Apotheosen steht die Wahrheit des Echten gegenüber. Eine Bande von Pseudokünstlern der Ecole des Beaux Arts und der Lärm und die Lieder der Ausflügler verleideten mir einen längeren Aufenthalt in Barbizon. Trotzdem habe ich in der Nähe von Millets Haus unvergeßliche Stunden verbracht, die mir in den Jahren strenger Zurückgezogenheit unschätzbaren Halt verliehen. |
|

