|
| |
Wie der Fall Glasenapp entstand door Stefan Heym
Eigentlich beginnt die Geschichte meines Romans Der Fall Glasenapp oder, wie er ursprünglich hiess, Hostages gar nicht mit dem Thema, von dem das Buch handelt: nämlich dem Untergrundkampf in Prag während der Nazizeit. Die Geschichte beginnt vielmehr mit einem verunglückten Theaterstück, das ich in meinen ersten Jahren in den USA geschrieben habe, ungefähr um 1940, einem Stück über Hanussen.
Ich weiss nicht, ob Sie sich an diesen Namen erinnern. Hanussen war ein Hellseher, der unmittelbar vor 1933 Furore gemacht hat, übrigens ein Jude, aber befreundet mit dem Grafen Helldorf, dem Nazi-Polizeipräsidenten von Berlin im Anfang des Jahres 1933. Hanussen, der jeden Abend öffentlich als Hellseher auftrat, sagte den Reichstagsbrand etwa fünf Tage vorher voraus, nicht, weil er ihn hellgesehen hätte, sondern weil er durch seinen Freund, den Grafen Helldorf, von dem Plan wusste. Und dann wurde Hanussen - bis heute ist das immer noch nicht aufgeklärt - ermordet aufgefunden.
Uber den Fall Hanussen schrieb ich also ein Stück, und nachdem ich es geschrieben hatte, traf ich einen Mann namens Max Pfeffer, der in Wien Theateragent gewesen und als Emigrant nach Amerika gekommen war und der nun versuchte, wieder auf seinem Gebiet anzufangen. Sein Büro trug er unterm Arm in seiner Aktentasche. Pfeffer unternahm es, das Stück unterzubringen, und fand tatsächlich einen bekannten Schauspieler, Joseph Schildkraut, der sich dafür interessierte, vor allem deshalb, weil Hanussen während des ganzen Stücks auf der Bühne stand: für Schildkraut, der diese Art Schauspieler war, das Gegebene. Aber auch Schildkraut kriegte keine Geldgeber und kein Theater für mein Stück.
Und da hatte ich eine neue Idee für ein zweites Stück und sprach darüber mit Max Pfeffer, und er sagte: ‘Weisst du, am New Yorker Broadway, das ist sehr schwer mit den Theaterstücken, man muss da einen Geldgeber haben, der viel Geld hat, man muss ein Theater finden, einen Produzenten - es wäre viel leichter, wenn du einen Roman schreiben würdest.’ Und ich sagte:‘Ich habe noch nie in meinem Leben einen Roman geschrieben.’ Und er sagte: ‘Was heisst das? Ich habe noch nie in meinem Leben einen Roman verkauft.’
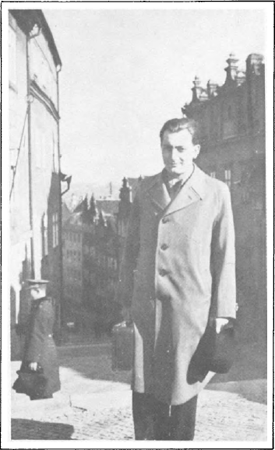
Auf dieser Basis begann die Arbeit an dem Roman Hostages, zu deutsch Die Geiseln, jetzt in der deutschen Ubersetzung Der Fall Glasenapp. Die Grundidee zu dem Buch trug ich schon lange im Kopf. Mein Vater war 1933 als Geisel verhaftet
| |
| |
worden; die ganze Frage der Geiselnahme bewegte mich sehr. Dazu kam, dass ich wirklich anfangen wollte, als Schriftsteller und Romancier zu arbeiten; ich war nach Amerika gekommen mit einem Stipendium als Student, hatte dann in Chicago 1935 angefangen zu studieren, nachdem ich 1933 bis 1935 in Prag in der Emigration war. 1937 beendete ich mein Studium mit dem schönen Titel ‘Magister der Künste’ - Master of Arts - und stand jetzt vor der Frage: was mache ich nun? Das war die Zeit der Wirtschaftkrise; zwar regierte Roosevelt schon, aber es war doch noch sehr schwer, Arbeit zu bekommen; es gab Millionen Arbeitslose. Ich wurde, nachdem ich als Kellner und Tellerwäscher und Buchhändler gearbeitet hatte, Redakteur an einer kleinen deutschsprachigen Antinazi-Wochenzeitung, die aber einen englischen Teil hatte; und da wir nicht das Geld hatten, einen Ubersetzer zu bezahlen, musste ich die englische Seite selber machen. Ich hatte vorher natürlich schon Englisch gelernt - hier, am Deutschen Volksecho, lernte ich, Englisch zu schreiben. 1939, als Hitler und Stalin ihren Nichtangriffspakt schlössen, wurde die Veröffentlichung dieser Wochenzeitschrift eingestellt, und ich arbeitete dann für eine Druckerei und begann, mich nebenher, wie es so schön heisst, als freischaffender Schriftsteller zu betätigen. Auch in Prag hatte ich schon so gelebt, hatte Gedichte und Feuilletons geschrieben und, zusammen mit Hans Burger, dem Dramaturgen des Prager Deutschen Theaters, ein Kinderstück. Nun zu Hostages. Da war der schon erwähnte Komplex Geiseln. Aber wie stellte man das dar? Ich überlegte mir sehr nüchtern: was für Bücher gehen hier in Amerika, was ist hier möglich, wo trifft man auf die wenigsten Widerstände? Die Antwort: Detektiv- und Kriminalromane. Aber wenn schon so etwas, dann musste man einen Kriminal-roman
schreiben, der anders war als das Ubliche, mit einer andern Formel. Was war nun das allen Kriminalromanen Gemeinsame? Das war, dass der Detektiv am Ende siegt. Also musste ich einen Detektiv wählen, der am Ende als Verlierer dasteht, und das konnte der Natur der Dinge nach nur ein Nazidetektiv sein.
Das war das zweite Element, das in die Story dieses Romans hineinkam. Und das dritte war: der Tod, Todesangst, Würde bewahren auch angesichts des Todes. Der Tod ist ein Thema, das alle Schriftsteller und Dichter schon irgendwie beschäftigt hat, und es beschäftigte mich zu der Zeit sehr stark. Mein Vater war auf tragische Art gestorben, und ich sah der Einberufung in die amerikanische Armee entgegen; es war eine Zeit des Krieges und der Konzentrationslager, und der Tod gehörte zum täglichen Erleben. Ich fragte mich: wie verhält sich der Mensch dem Tod gegenüber, wie verhält er sich besonders dem sicheren, dem an einem bestimmten Datum zu erwartenden Tod gegenüber - das war bei den Geiseln der Fall.
Aus diesen drei Elementen entstand der Roman Hostages - Der Fall Glasenapp -, zugleich Detektiv- und psychologischer Roman, ohne dass dabei die Liebe zu kurz käme oder der Untergrundkampf des tschechischen Volks gegen die Nazis. Ich empfand dem tschechischen Volk gegenüber eine tiefe Dankbarkeit. Ob sie nun Tschechen, Juden oder deutschsprachige Linke gewesen waren, sie hatten mich, den jungen Emigranten, in den zwei Jahren, die ich in Prag lebte, gastlich aufgenommen und mir sehr geholfen; ich habe viele Freunde dort gefunden. Und da ich Prag und Umgebung und die Menschen dort kannte, lag es nahe, die Handlung dorthin zu verlegen. Und dann kam noch etwas hinzu, das mich interessierte: Schwejk. Ich habe den Schwejk von Hasek immer geliebt, und ich habe mich, wie auch Brecht damals, gefragt: wie würde so ein Schwejk sich im zweiten Weltkrieg verhalten? Würde er sich ähnlich verhalten wie im ersten, oder würde er bewusster sein, politischer? Ich glaubte, diese Frage mit Ja beantworten zu können, und so schuf ich als Hauptfigur in Hostages den Janoschik - ein bösartiger Kritiker hat ihn einmal den Schwejk vom Dienst genannt -, Janoschik, der deutlich Schwejksche Züge trägt, in Wirklichkeit aber ein politischer Führer ist, der in einer ganz schwierigen Situation, nämlich in der Haft, in der Zelle heraus das illegale Unternehmen weiterzuführen, für das er verantwortlich war.
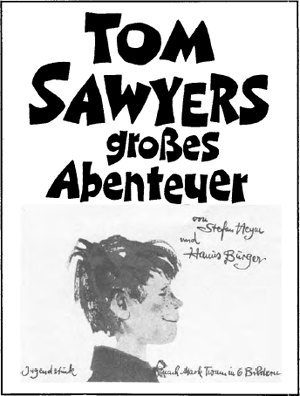
So also sah das Material aus, das ich hatte. Ich sagte mir, es hat keinen Zweck, das Buch auf deutsch zu schreiben, schreibe es gleich in englischer Sprache; es konnte ja kaum in Deutschland erscheinen zu der Zeit, sondern nur in Amerika und in England. Mein erstes Buch wurde daher auch mein erstes Buch in englischer Sprache, und meine späteren Romane wurden gleichfalls zunächst englisch geschrieben.
Habent sua fata libelli, wie die Lateiner sagen, die Büchlein haben ihre Schicksale. Hostages hat ein ausgiebiges Schicksal gehabt. Ich hatte kaum zwei Kapitel geschrieben und einen Plan ausgearbeitet für den Rest des Buches; aber Max Pfeffer, mein literarischer Agent, von dem ich schon erzählte, war genauso knapp bei Kasse wie ich, und er sagte: ‘Die zwei Kapitel nehme ich jetzt zu einem Verlag, vielleicht können wir jemanden kriegen, der darauf anheisst, und einen Vorschuss, und dann können wir schon weitersehen.’ Er ging also zu einem Verlag, zu Putnam's. Und bei Putnam's las man diese zwei Kapitel und den Plan, und zu meiner und, wie ich glaube, auch
| |
| |
zu Pfeffers grosser Uberraschung sagte der Verleger: ‘Ja, das möchten wir nehmen’.Die Herren schlugen nun einen Vertrag vor, und sie haben einen winzigen Vorschuss gezahlt; aber für meine Verhältnisse damals war er beträchtlich. Obwohl ich meine Mutter mit zu ernähren hatte, machten es mir die paar hundert Dollar möglich - damals war der Dollar noch etwas wert -, nur vormittags in der Druckerei zu arbeiten, in der ich tätig war, und mir den Nachmittag zum Schreiben freizunehmen. Nachmittags und abends sass ich in meinem Zimmer in den Slums der Ostseite von Manhattan auf einem alten Sofa, meine Schreibmaschine auf dem Schoss, die ich mir 1932, noch in Deutschland, von meinen Honoraren für meine ersten Gedichte gekauft hatte, und hämmerte das Buch heraus. Damals lernte ich meine erste Frau kennen, eine Amerikanerin, Redakteurin von Beruf, die mir mit ihrem kritischen Urteil und ihrem feinen Gefühl für die englische Sprache sehr half.
Ich arbeitete rasch, aber nicht rasch genug für den Pleitegeier. Der Tag kam, an dem ich kein Geld mehr hatte, aber ich musste noch vier oder fünf Kapitel schreiben, sehr konzentrierte Arbeit. Ich bat Pfeffer, noch einmal zu dem Verlag zu gehen und zu sagen, dass ich noch zweihundert Dollar brauchte. Und der Verlag erklärte: ‘Wir sind gern bereit, Ihnen diese zusätzlichen zweihundert Dollar vorzuschiessen, wir möchten aber dafür eine Klausel in dem Vertrag geändert haben.’ Diese Klausel bezog sich auf ein Nebenrecht. Wenn nämlicn, so hiess es in dem Vertrag, die Filmrechte an eine Filmgesellschaft vor Veröffentlichung des Buches verkauft werden, dann bekommt der Verlag einen Anteil von 10 Prozent; geschieht dies aber nach Veröffentlichung des Buches, nachdem also der Verlag durch seine Arbeit schon etwas für das Buch getan hat, erhält der Verlag 20 Prozent. Die Herren sagten: ‘Für den zusätzlichen Vorschuss in Höhe von zweihundert Dollar, Herr Heym, gestatten Sie uns bitte, diese Klausel dahingehend zu ändern, dass unser Anteil an den Filmrechten 20 Prozent beträgt, gleichgültig, ob die Filmgesellschaft die Rechte vor oder nach Veröffentlichung des Buches erwirbt.’ Ich aber sagte mir: Das kauft doch eine Filmgesellschaft nie. 10 Prozent von null ist null, und 20 Prozent von null ist null; warum sollen Putnam's nicht ihre 20 Prozent haben. Was ich nicht wusste, was aber der Verlag wusste, das war, dass eine Filmgesellschaft an der Sache schon interessiert war. Und acht Tage, nachdem ich diese Klauseländerung genehmigt hatte, kamen die Herren vom Verlag zu mir und sagten: ‘Ach, Herr Heym, wir können Ihnen freundlich mitteilen, dass Paramount die Filmrechte haben möchte, und sie bieten 20 000 Dollar.’ Auf diese Weise hat der Verlag für die zweihundert Dollar
Vorschuss an mich zweitausend Dollar in die eigene Tasche verdient. Seit der Zeit bin ich Verlegern gegenüber etwas zurückhaltender und vorsichtiger geworden. Ubrigens bringt derselbe Verlag, der damals Hostages in den USA veröffentlichte, jetzt den König David Bericht heraus; der Chef heute ist der Sohn des Mannes, der mir die 10 Prozent wegeskamotierte.
Weg von den Finanzen. Das Buch kam im Herbst 1942 heraus. Nun arbeitet die Kritik in den USA rascher als hierzulande; Bücher, die man für wichtig hält, werden am Tag des Erscheinens von den führenden Blättern besprochen. Die Morgenausgabe der New York Times, das weiss in New York jeder, erscheint elf Uhr nachts. Ich ging also zum Union Square an der 14. Strasse in New York, ich wohnte ja in der Nähe, und setzte mich in Childs' Restaurant und ass, ich weiss es noch wie heute, Pancakes, eine Art heisser Fladen, auf die man noch süsses Zeug giesst, und stopfte das aus Nervosität in mich hinein, bis ich um elf Uhr endlich am Zeitungsstand draussen die New York Times ankommen sah; und nun hoffte ich, dass da was drinsteht. Es stand auch was drin - eine Kritik aus der Feder des führenden Kritikers der New York Times, Orville Prescott, in der er mich in eine Reihe mit Thomas Mann und Leuten von ähnlichem Kaliber stellte; übertrieben oder nicht, jedenfalls war es eine herrliche Kritik, und andere Zeitungen äusserten sich ähnlich positiv zu dem Buch, und Hostages wurde innerhalb kurzer Zeit ein Bestseller. Ich war plötzlich aus der Armut heraus und aus der ganzen Misere und war zu einem für mich unvorstellbar reichen Mann geworden. Ich besass nun, weiss ich, etwa 10 000 Dollar auf der Bank, denn von den 20 000 ging natürlich allerhand ab; dazu kamen die Bucheinnahmen. Ich hatte Geschmack an der Sache bekommen und setzte mich sofort an ein neues Buch, das nie veröffentlicht wurde, weil es so schlecht war. Und dann geschah, was ich schon längst erwartet hatte: ich wurde einberufen. Ich kam in die Armee als gewöhnlicher Soldat, ich war kein prominenter Autor mehr, ich war ein Rekrut, der genau dieselbe Drecksarbeit machen musste wie andere Rekruten und über den Kasernenhof gehetzt wurde wie andere.
Während ich Küchendienst machte und mit der Gasmaske vor der Nase durch die weniger schönen Gegenden von Missouri marschierte, drehte man bei Paramount den Film nach meinem Roman; das Mädchen Milada wurde von Luise Rainer gespielt, einer deutschen Schauspielerin, sehr zartes Figürchen, gleichfalls eine Emigrantin; den Janoschik spielte William Bendix, eigentlich ein Komiker; aber es stellte sich heraus, dass er gar nicht schlecht war in seiner neuen Rolle und eine wirkliche Arbeitergestalt schuf, einen jener unscheinbaren Helden des Untergrundkampfes. Im ganzen wurde es ein recht brauchbarer, spannender Film, natürlich gemacht mit den künstlerischen Mitteln von damals. Dieser Film hat mich durch meine Armeelaufbahn hindurch verfolgt. Kaum traf ich in meinem neuen Army Camp in Staate Maryland ein, kam auch Hostages dahin. Kaum landete ich in London, ein paar Monate vor D-Day, wurde auch dort Hostages in den Kinos gezeigt, sehr zum Amüsement der Leute in meiner Kompanie, die behaupteten, ich hätte das arrangiert. Interessant war die Behandlung des Films durch die Kritik. Die Hearst-Presse - ich weiss nicht, ob Hearst ein Begriff für Sie ist, der Millionär Hearst war der Bezitzer des reaktionärsten amerikanischen Pressekonzerns - die Hearst-Presse, die den Roman Hostages nie erwähnt hatte, griff den Film scharf an: weil da ein Kommunist als Held dargestellt würde. Als der Roman später in der DDR erschien, beklagte ein Kritiker des Neuen Deutschland im Gegenteil, dass darin überhaupt kein Kommunist vorkäme - so divergieren die Meinungen. In Wirklichkeit war der Film eben ein Hollywood-Film: Liebe in Untergrund-Prag, viel mehr nicht.
Hostages wurde in viele Sprachen übersetz, und das Buch hat auch in anderen Sprachen seine Schicksale gehabt. Es erschien noch während des Krieges auf russisch; es kam in England heraus; und es erschien in französischer Sprache, aber
| |
| |
noch nicht in Paris, Paris war noch nicht frei, es erschien in Algerien, da die Nazis aus Algerien viel früher vertrieben wurden als auch Frankreich. Wie Sie wissen, fand in Algier nach dem Kriege ein Befreiungskampf gegen die französische Kolonialmacht statt, und ich traf in Berlin in späteren Jahren einen Algerier, einen Arzt, der in der algerischen Befreiungsarmee mitgekämpft hatte und der mir erzählte, wie sehr die französiche Ausgabe dieses Buches ihm und seinen Freunden in der Befreiungsarmee geholfen habe, wie es sie in schwierigen Situationen ermutigte weiterzukämpfen.
Wenn ein Schriftsteller ein Buch schreibt, so weiss er ja nicht, wie es wirken wird. Es gibt eine literarische Wirkung, die Leute mögen das Buch oder mögen es nicht. Aber ein Buch hat unter Umständen auch eine direkte Wirkung, es feuert die Leser an zu gewissen Handlungen, es regt sie an zu gewissen Gedanken. Ich erfuhr etwas ganz Ahnliches auf Zypern. Ick kam nach Zypern, um dort nach einer Krankheit Winterurlaub zu machen, und traf in Famagusta einen zypriotischen Griechen, der in der Zeit, als die Engländer die Insel beherrschten, an der Befreiungsbewegung dort teilgenommen hatte. Der Mann behauptete, mein Buch zu kennen, es sogar zu besitzen. In welcher Ausgabe, welcher Sprache, wollte ich wissen. ‘Griechisch selbstverständlich’, sagte er. ‘Aber ich weiss nichts von einer griechischen Ausgabe’, sagte ich. ‘Wie sind Sie denn zu dem Buch gekommen?’ - ‘Das Buch’, sagte er, ‘war in der Bibliothek des Konzentrationslagers, in dem die Engländer mich gefangenhielten; es hat uns ermutigt durchzuhalten, denn angenehm waren die Verhältnisse dort nicht; und als das Lager aufgelöst wurde und wir freigelassen wurden, nachdem die Engländer abrücken mussten aus Zypern, da habe ich mir das Buch aus der Bibliothek des Konzentrationslagers mitgenommen.’ Ich sagte: ‘Zeigen Sie's doch mal.’ Er hatte es da, zu Hause in seiner kleinen Bibliothek, in einem Kunstledereinband, den die Bücher in der Konzentrationslagerbibliothek bekommen hatten, und mit dem Stempel des britischen Zensors: ‘Passed for the Library’; die Ausgabe war in Athen erschienen; die Rechte hatte der Verlag einfach gestohlen. Ich bat meinen Freund, mir dieses Exemplar doch zu schenken, und das hat er dann getan, und es ist, glaube ich, unter den verschiedenen Ausgaben von Hostages, die ich zu Hause in meinem
Bücherschrank habe, für mich die wertvollste.
Hostages, ist später in der DDR erschienen, unter dem Titel Der Fall Glasenapp, und wurde auch bei uns ein Bestseller; ich glaube, es hat jetzt die neunte oder zehnte Auflage erlebt, das sind etwa 100 000 verkaufte Exemplare. Es erschien in der DDR ziemlich spät erst, und zwar, weil ich mir vorgenommen hatte, die Ubersetzung selbst zu machen. Ich hatte oft Schwierigkeiten mit der Ubersetzung meiner Bücher ins Deutsche; Ubersetzen ist überhaupt eine böse Sache, wenn einer die Sprache, in die sein Buch übersetzt wird, selber versteht. Ich nahm mir also vor, Hostages selbst zu übersetzen, fand aber die Zeit nicht, und erst als ich ins Krankenhaus kam wegen irgend welcher Herzbeschwerden und dort sechs Wochen liegen musste, nahm ich mir ein Tonbandgerät und diktierte die Ubersetzung.
Ich bin oft gefragt worden: Warum schreiben Sie in englischer Sprache, obwohl Sie in Deutschland geboren sind und seit Jahren wieder in einem deutschen Staat leben? Die Antwort ist: Das hat sich so ergeben. Die Existenz als Emigrant in den Vereinigten Staaten war nicht leicht; ich habe mich relativ rasch ins amerikanische Leben eingefügt, ich war ja noch sehr jung, als ich hinkam, gerade zweiundzwanzig Jahre alt. Bei meiner Ankunft konnte ich nur ein bisschen Schul-Englisch. Ich erinnere mich noch, als ich im Zug von New York nach Chicago fuhr, um dort mein Studium an der Universität zu beginnen, da fragte ich den Pullman-Schaffner: ‘Please, where is the double-jusi?’ Er hat mich sonderbar angekuckt; er wusste überhaupt nicht, wovon ich sprach, denn dort heisst das Ding ‘Men's Room’. Ich musste dann, da ich direkt ins Studium kam, sofort in der Praxis Englisch lernen. Ich hatte Glück; ich geriet in ein Studentenheim mit amerikanischen Studenten, die kein Wort Deutsch sprachen, und ich musste mich einfach mit meiner neuen Umwelt auseinandersetzen. Innerhalb von ein paar Wochen konnte ich dann wenigstens soviel Englisch, dass ich an der Universität hören konnte. Auf diese Art habe ich auch Englisch zu schreiben gelernt: aus der Praxis heraus. Ich glaube, das ist die beste Art, eine Sprache zu lernen. Und heute schreibe ich in zwei Sprachen, und ich meine, das ist ein Vorteil. Ubrigens bin ich da gar keine grosse Seltenheit - denken Sie an Joseph Conrad, denken Sie an die vielen Schriftsteller aus den ehemaligen Kolonialländern, die zumeist auch zwei Sprachen beherrschen und in zwei Sprachen schreiben - der ihres Stammes oder ihres Volkes und auf englisch oder französisch. Ich habe immer festgestellt, dass die beiden Sprachen in meinem Kopf einander befruchten; natürlich muss ich darauf achten, dass keine Anglizismen ins Deutsche und keine Germanismen ins Englische
geraten.

uit: Eröffnungen - Schriftsteller über ihr Erstlingswerk
Aufbau Verlag Berlin und Weimar 1974 |
|
|